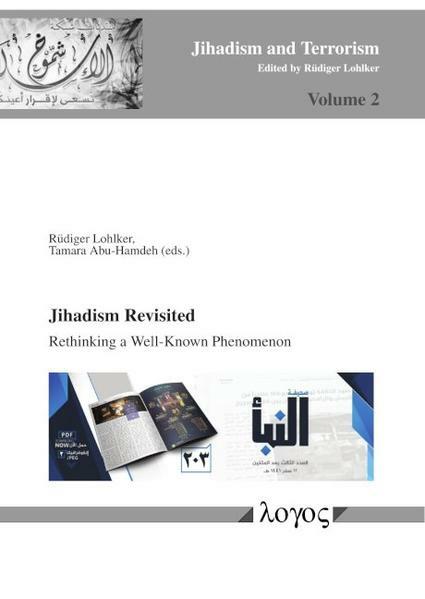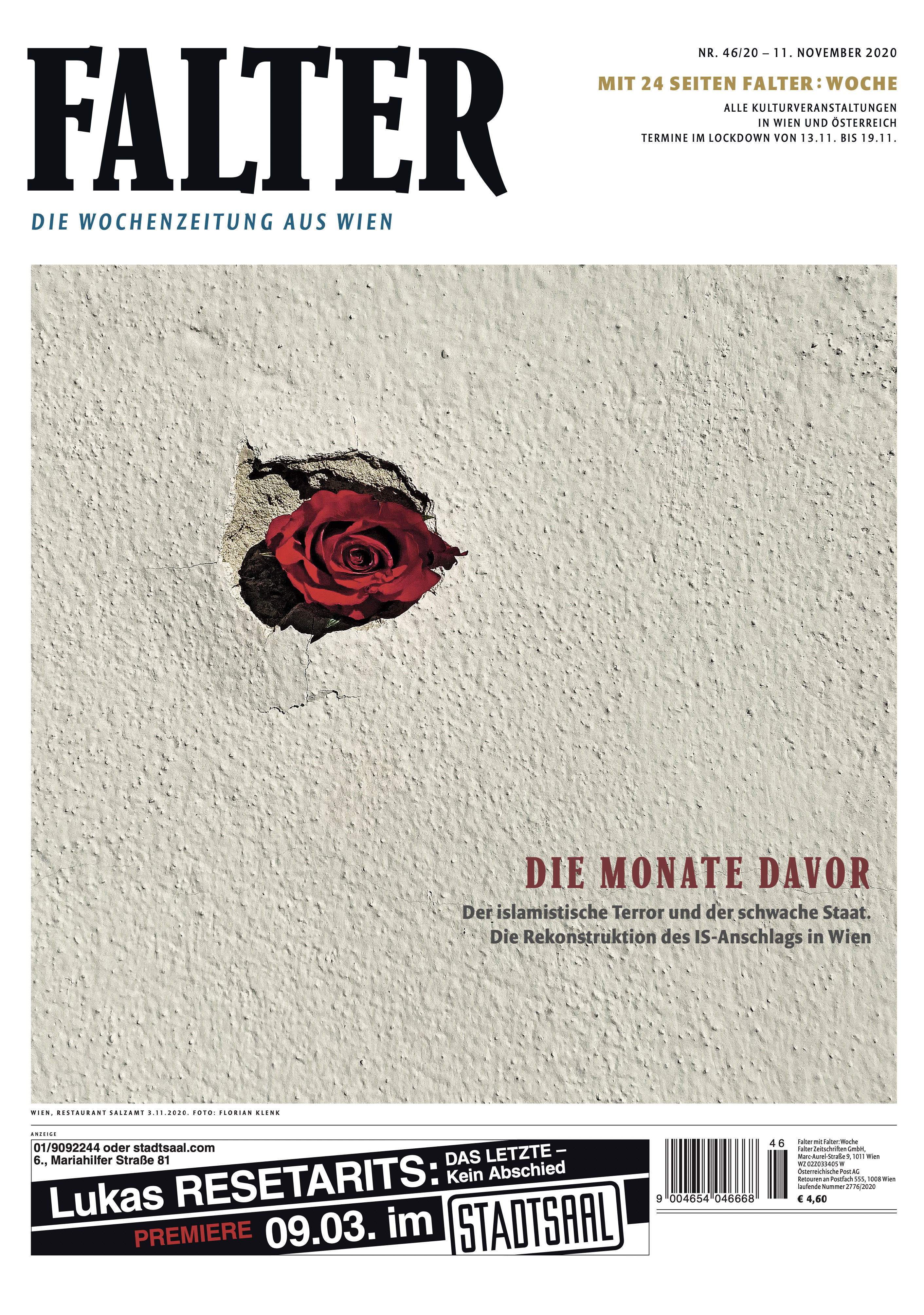
„Der IS stiehlt unsere Kinder“
Stefanie Panzenböck in FALTER 46/2020 vom 11.11.2020 (S. 35)
Als die Welt am 11. September 2001 erschüttert wurde, war jener Mann, der in Wien vergangene Woche einen Terroranschlag verübt hat, gerade einmal ein Jahr alt. Als der sogenannte Islamische Staat (IS) sich formierte, war der Wiener Kujtim F. ein Kleinkind. Mit 18 entschloss er sich, über die Türkei in den IS zu reisen, wurde aber vorher verhaftet. Welche Vorstellungen trieben Kujtim F. dazu, sich dieser Bewegung anzuschließen? Und was hat der IS mit dem Islam zu tun?
Mit dem Falter machte sich Rüdiger Lohlker, Professor für Islamwissenschaften an der Universität Wien, auf eine gedankliche Reise: von der Radikalisierung eines Jugendlichen über die Realität des IS bis zur Deradikalisierung.
Falter: Herr Lohlker, ist der Dschihad gegen den Westen – und gegen alle anderen – für Jugendliche noch immer ein attraktives Angebot?
Rüdiger Lohlker: Ich bin dankbar, dass Sie auch von „allen anderen“ sprechen. Es geht nicht nur gegen den Westen, sondern letztendlich gegen alle anderen Menschen. Der IS beansprucht für sich, den „wahren Islam“ zu vertreten, und wer sich dem nicht anschließt, ist ungläubig, also des Todes. Das Weltbild des IS ist eine Antiposition. Und das ist der Verknüpfungspunkt zu Jugendlichen. Denn in der Pubertät befindet man sich oft in einer Opposition zu seinem Umfeld. Man ist verunsichert, als männlicher Jugendlicher insbesondere durch das andere Geschlecht, und sucht eine Peergroup. Ein Rekrutierer des IS bietet in all diesen Bereichen Orientierung.
Um welche männliche Identität geht es?
Lohlker: Es geht um das, was der Schriftsteller Klaus Theweleit als „Körperpanzer“ bezeichnet hat. Damit ist man dann ein festgefügter junger Mann, der sich in der Welt behaupten und auch erwarten kann, mit Frauen belohnt zu werden. Es gibt genug Beispiele, dass Sympathisanten des IS nach Syrien gegangen sind, weil es dort Frauen gibt, auch Pizza, Sneakers, Autos, Häuser.
Genau das gibt es in Europa ja auch.
Lohlker: Aber der Jugendliche, der nach Syrien will, hat das nicht bekommen. Er ist wahrscheinlich sozial marginalisiert, hat wenig Geld. Dann wird es schwierig.
Wir leben in einer liberalen, soften Gesellschaft. Warum braucht es im Jahr 2020 einen Körperpanzer?
Lohlker: In der Wahrnehmung dieser jungen Leute geht es um eine globale Sicht. Für sie stehen Muslime weltweit unter Druck, werden angegriffen und müssen verteidigt werden. Wir betrachten die Dinge zu sehr aus der west- oder mitteleuropäischen Sicht.
Es ist nicht der Bursche aus der Wiener Vorstadt.
Lohlker: Es ist der Muslim aus der Welt, in der Wien liegt.
Ist es für diese jungen Männer wichtig, als IS-Mitglied Gewalt ausüben zu dürfen?
Lohlker: Es geht um ein Leben in Wohlstand und Macht. Das ist miteinander verknüpft. Sie sagen sich: Ich erreiche all das, auch meine herausragende Rolle in der Gruppe, wenn ich bereit bin, Gewalt auszuüben. Moment, ich öffne das gerade ...
Wohin schauen Sie da gerade?
Lohlker: Das ist ein Telegram-Kanal. Hier ist zu sehen, dass der Terrorist von Wien inzwischen in der Fankultur des IS angekommen ist, als Abu Dujana al-Albani. Er hat also schon seinen Kampfnamen. Der Name taucht hier mit der üblichen Formel „Gott möge ihn annehmen“ auf. Es geht auch darum, dass ihn die Paradiesjungfrauen erwarten und ihm zulächeln.
Welche Rolle spielt der digitale Raum im Gegensatz zu Moscheen bei der Radikalisierung?
Lohlker: Schon seit einigen Jahren ist festzustellen, dass Jugendliche von Moscheen schwer erreichbar sind. Jugendliche, die zu solch extremen Positionen neigen, sogar noch weniger. Sie erkennen die Moscheeautoritäten gar nicht an, weil diese ihrer Ansicht nach nicht den „wahren Islam“ vertreten. Radikalisierung geschieht im privaten Rahmen. Das heißt, eine Gruppe von Freunden schaut sich Videos an, spricht darüber, dann schwappt das über ins Online-Milieu.
Das heißt, der reale Raum ist neben dem virtuellen sehr wichtig?
Lohlker: Ich muss die Menschen spüren. Eine Gruppe entsteht aus einer Emotion heraus. Es war ein grundlegender Fehler anzunehmen, dass die Online-Radikalisierung das Primäre ist.
Die Online-Welt ist nur eine Verstärkung der realen?
Lohlker: Ja. Wobei praktische Vorbereitungen für einen Anschlag oft im digitalen Raum passieren. Es gibt vom IS eine Plattform, die sich technischen Angelegenheiten widmet. Dort erfährt man, wie man welches Gift zubereitet, wie man es einsetzt, wie man einen Schalldämpfer baut, der gut funktioniert. Das können Sie alles online finden.
Ist der IS überhaupt noch lokalisierbar? Seine militärische Basis ist ja zerstört.
Lohlker: Das ist ebenfalls ein großer Irrtum. Zwar ist das Territorium in Syrien und im Irak verloren gegangen. Aber es finden dort noch intensive Aktivitäten statt. Das nur nebenbei. Außerdem gibt es inzwischen weltweit Präsenzen des IS. In Nordafrika, auf der Arabischen Halbinsel, in Westafrika, in Zentralafrika, in Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, Indien, auf den Philippinen. Und nun auch wieder in Europa. Es ist kein virtuelles Kalifat. Es ist ein aktives, ein am Boden kämpfendes Kalifat.
Wie schaffen es die Jugendlichen, die imaginierte Gewalt in reale umzusetzen? Gibt es militärische Übungen? Oder sind das nur Online-Planspiele?
Lohlker: Mit diesen extremen Gewaltvideos wird die Kerngruppe des IS adressiert. Unter dem breiteren Publikum ist es nicht mehr so populär, dabei zuzuschauen, wie Menschen massakriert werden. Für den inneren Kreis aber sehr wohl. Der Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich ist ein Resultat davon. Eine Enthauptung ist in der Welt des IS ein normales Vorgehen. Das wird immer wieder in Videos gezeigt, wie Menschen der Hals durchgeschnitten wird und sie ausbluten. Es findet eine Gewöhnung an Gewalt im virtuellen Raum und im persönlichen Kontakt statt.
Jetzt mag der Attentäter von Wien eine pubertäre Krise gehabt haben. Aber reicht das aus, um den Schritt aus der Gruppe in Wien Richtung Syrien zu tun, wie es Kujtim F. im Jahr 2018 gemacht hat?
Lohlker: In der Gruppe wird immer wieder diskutiert, wer mutig genug ist zu gehen. Das ist ein Aufschaukelungsprozess. Wer macht es tatsächlich? Dabei wird die Realität des Krieges ausgeblendet.
Welche Vorstellung hat jemand wie Kujtim F. vom IS?
Lohlker: Er denkt, dass er kämpfen kann und dass er das ganze Belohnungsprogramm erhält. Wenn er stirbt, so meint er, wird er, wie jetzt auch zu sehen ist, in die Fankultur eingespeist. Die Sympathisanten sehen ihn immer wieder und werden daran erinnert, dass er ein Kämpfer für den Islam war. Doch Dschihadis, und das können wir seit Jahren beobachten, sind extrem fragil. Ich zitiere gern ein Gedicht, das sinngemäß lautet: „Wenn der Emir“, also der Anführer, „verschwindet, stürze ich in ein schwarzes Loch und löse mich auf.“ Das heißt, die Struktur der Gruppe ist absolut notwendig. Allein sind sie nichts.
Immer wieder kommt das Argument, dass die Erstarkung rechtspopulistischer Politik in Europa den Prozess der Radikalisierung befeuert hat. Wie sehen Sie das?
Lohlker: Es gibt empirische Evidenz, die dafür spricht. Kollegen von mir haben Anfang der 2000er-Jahre bei muslimischen Jugendlichen in Frankreich beschrieben, wie sich in der Pubertät ein Schalter umlegt. Sie merken, dass sie nicht dazugehören. Es gibt eine verstärkte Diskriminierung, das lässt sich nicht bestreiten. Die zentrale Frage ist nicht nur: Warum radikalisieren sich Jugendliche? Sondern: Wieso passiert das bei der großen Mehrheit nicht?
Kujtim F. ist in Syrien nicht angekommen, die türkische Polizei hat ihn vorher festgenommen. Was hätte ihn, einen jungen, unausgebildeten Dschihadi aus Österreich, im sogenannten Islamischen Staat damals in Syrien erwartet?
Lohlker: Zuerst hätte man ihm einen Fragebogen in die Hand gedrückt. Über Herkunft, Islamkenntnisse, den Karriereweg, den er im Auge hat. Wir haben ja etliche dieser Fragebögen erhalten, und da gibt es auch die Möglichkeit, das „Martyrium“, das „Istischhad“, einzutragen. Hat jemand technische Fähigkeiten, würde er das eher nicht auswählen, weil er dem IS in anderer Hinsicht nützlich sein könnte. Der Wiener Attentäter wäre wohl Kanonenfutter geworden, ein potenzieller Selbstmordattentäter in Syrien. Und sei es, dass er mit Handschellen an das Lenkrad gefesselt worden wäre. Hat es alles gegeben. Das wäre der direkte Weg ins Paradies.
Welche Möglichkeiten hätte es noch für jemanden wie Kujtim F. gegeben?
Lohlker: Medizinische oder handwerkliche Kenntnisse wären von Nutzen gewesen, vertiefte religiöse Kenntnisse, um in der Abteilung für Islamisches Recht zu arbeiten, um Fatwas zu erstellen. Man sprach beim IS oft von einem Pseudostaat. Aber er war tatsächlich ein gut organisiertes bürokratisches Gebilde. Was nicht verwunderlich ist, weil führende Mitglieder aus dem irakischen Geheimdienst gekommen sind. Die waren durch und durch bürokratisch.
Hätte er dann Haus und Frau, wie versprochen, zugeteilt bekommen?
Lohlker: Das war durchaus üblich. Wenn eine Frau ihren Mann verloren hat, weil er getötet wurde, wurde sie jemand anderem zugeteilt. Das galt auch für die Sklavinnen.
Wie hätte der Alltag eines europäischen Dschihadis im IS ausgesehen?
Lohlker: Er hätte gemeinsam mit den Brüdern in einer entsprechenden Unterkunft gelebt. Wenn eine Frau da gewesen wäre, hätte es auch die Möglichkeit gegeben, ein eigenes Haus zu beziehen. Er wäre seiner Arbeit nachgegangen, hätte viel im Koran gelesen. Ob er ihn verstanden hätte, ist eine andere Frage. Er wäre indoktriniert worden, hätte theologischen Unterricht bekommen, hätte Videos angeschaut. Er hätte Schriften des IS gelesen, zum Beispiel das Wochenjournal. Das ist mittlerweile, ohne Unterbrechung, bei Nummer 259 angelangt, mit den Morden von Wien auf der Titelseite.
Was bedeutete der Krieg für die dort lebenden Kämpfer im Alltag?
Lohlker: Es war nicht überall Krieg. Es gab auch eine Art Leben in den Ruinen, und man konnte sich darin einrichten. Nicht zu vergessen, die Kämpfer bekamen auch ihr Gehalt. Durch den Territorialverlust hat sich das vielleicht geändert, das kann ich nicht sagen.
Was wäre passiert, wenn dieser europäische Dschihadi im IS einen Fehler gemacht hätte? Eine kritische Frage gestellt, oder seine Frau sich nicht ordentlich bedeckt hätte?
Lohlker: Die Frau wäre eventuell von Frauen kontrolliert worden, die offenbar gegen ihre Geschlechtsgenossinnen ziemlich brutal vorgegangen sind. Es geht aber auch anders: Vor kurzem habe ich eine Untersuchung zu Fatwas des IS geschrieben. Da beklagte sich etwa eine Frau, dass ihr Mann sich negativ über den IS geäußert hat. Im schlimmsten Fall wird der Mann als Häretiker verurteilt und getötet. Oder, das ist durchaus üblich gewesen, er wird überzeugt, dass er die Stufe des Märtyrers erreichen kann. Damit hat sich das Problem auch gelöst.
Sie erzählen diese Dinge mit einer
gewissen ironischen Distanz.
Ist das auch ein Selbstschutz
gegenüber diesen
Grauslichkeiten?
Lohlker: Sicher ist es das. Ich beschäftige mich seit der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre damit. Wenn ich diese Distanz nicht hätte, würde ich es nicht aushalten.
Oft wird gesagt, der Islamische Staat
oder andere Formen des Islamismus
hätten mit dem Islam an sich,
der Religion, nichts zu tun.
Sie wiederum vertreten die Ansicht,
dass man in der Terrorismusforschung
sehr wohl sein Augenmerk
auf die religiösen Lehren legen sollte. Warum ist das wichtig?
Lohlker: Viele Musliminnen und Muslime sagen, und ich kann das verstehen: Das hat nichts mit meinem Islam zu tun. Aber ich bin nun mal Islamwissenschaftler und frage nicht nach dem wahren Islam. Das ist nicht mein Job. Wenn man die religiösen Aussagen des IS ignoriert, ignoriert man auch Möglichkeiten, gegen ihn vorzugehen. Dann hat man auch ein Problem bei der Deradikalisierung im Gefängnis. Ich kann mit einem Häftling nicht über seine islamischen Ideen reden, wenn ich nichts mit Religion zu tun haben will.
Der IS reklamiert den „wahren Islam“ für sich. Was bedeutet das in groben Zügen?
Lohlker: Die Orientierung an Gott ist zentral. Das bedeutet laut IS: Wir müssen den Willen Gottes, wie er im Koran geäußert ist, vollziehen. Wer dies nicht tut, ist ungläubig und damit des Todes. Zur Not bringen wir all diese Menschen um, Hauptsache das Wort Gottes auf Erden herrscht. Dieses Ziel soll durch die kämpfende Gruppe, die von einem kämpfenden Imam, dem Kalifen, angeführt wird, realisiert werden. Es geht also um Abgrenzung: Ich will nur mit den wahren Gläubigen zusammen sein. Von allen anderen distanziere ich mich, töte oder unterwerfe sie. Zudem geht es um die Auslöschung jeglicher Abweichung, etwa von Menschen, die als homosexuell markiert werden, oder Frauen, die sich nicht entsprechend verschleiern. Außerdem geht es um die Rekonstruktion einer ideal imaginierten islamischen Vergangenheit.
Was gehört da dazu?
Lohlker: Der Golddinar wird propagiert als wertvolles Zahlungsmittel im Gegensatz zu irgendwelchen Papierfetzen wie dem Dollar. Wichtig ist auch: Wir müssen kämpfen, damit die Endzeit kommt und das wahre Paradies auf Erden entsteht. Das wird begründet mit dem, was ich Textarchäologie nenne.
Was bedeutet das?
Lohlker: Der IS forstet das Islamische Erbe durch und holt sich das heraus, was er brauchen kann. Es gibt im islamischen Recht Bestimmungen über den Schutz von Kriegsgefangenen. Was macht der IS? Er holt sich einen Text, in dem steht, dass ein Gefährte des Propheten das Blut der Gefangenen auf der Erde hat fließen lassen. Oder das Verbrennen von Gefangenen: Der Prophet hat das abgelehnt. Der IS sucht sich jedoch eine Textstelle, wo ein Gefährte Mohammeds das sehr wohl gemacht hat. Da wird der Prophet plötzlich uninteressant.
In Frankreich gibt es auch die Diskussion, dass sich der Dschihadismus nicht in erster Linie aus Koran-Quellen, sondern aus der Popkultur speist, aus Action- und Horrorfilmen. Wie sehen Sie das?
Lohlker: Die religiösen Kenntnisse sind meist nicht sehr ausgeprägt. Es gab einmal eine Liste von 25 Begriffen, die man auswendig lernen sollte, um unter den Brüdern und Schwestern anerkannt zu werden. Es gibt etwa die Formel „Der Islamische Staat wird fortdauern“. Wenn ich das auf Arabisch schreiben und sagen kann, bin ich Teil der Gruppe. Von einer theologischen Bildung können wir nicht sprechen. Das wäre eher ein Hindernis. Und dann kommt die Popkultur. Vor Jahren gab es ein Video, in dem ein Schwert gezeigt wurde, von dem Blut tropft: Das Bild stammte aus einem der Filme über die Perserkriege. Überhaupt ähnelt die Bildsprache der Videos sehr einem Ego-Shooter-Spiel. Deshalb spreche ich auch von dschihadistischen Subkulturen, mit einer bestimmten psychischen Disposition und bestimmten Codes. Ein bestimmter Bart ist wichtig, der nicht gepflegt ist, bestimmte Hosen, die über dem Knöchel enden. Bei Frauen ist es relativ einfach. Man sieht sie nicht.
Warum ist es für junge Frauen faszinierend, sich dem IS anzuschließen, sich einem Mann zu unterwerfen?
Lohlker: Es ist nicht die Unterwerfung, an die gedacht wird, sondern der Ritter in der schimmernden Rüstung. Auch das Helferinnensyndrom ist nicht zu unterschätzen, oder Verliebtheit. Rekrutierer haben es geschafft, online junge Frauen in sich verliebt zu machen. Manchmal ist es schiefgegangen, dann war es eine Journalistin. Sonst hat es leider sehr gut funktioniert. Es geht nur in Einzelfällen um Religion, eher um eine Attraktivität oder eine bestimmte Form von Sicherheit.
Wie kann man im IS als Frau Sicherheit finden?
Lohlker: Indem man sagt: Dort ist ein Land, wo ich als Muslimin unbeeinträchtigt leben kann. Und ich habe dadurch eine klare Rolle. Als Frau bin ich diejenige, die züchtig lebt, keiner Versuchung ausgesetzt ist und den Mann, der ein Kämpfer ist, unterstütze. Ich ziehe die Kinder auf und bin auch bereit, eine Waffe zu benutzen. Oft wurden Bilder gezeigt von Frauen, die sich eine Kalaschnikow umgehängt hatten, mit den Kindern im Park oder einkaufen waren.
Geht es bei den Frauen auch um den Körperpanzer, über den wir zu Beginn gesprochen haben?
Lohlker: Die Verschleierung ist der Schutz vor der Versuchung. Auch die Frauen sagen oft, dass sie dadurch vor allen möglichen schlechten Einflüssen sicher sind. Der Körper ist ein männliches Thema. Die gepanzerte Männlichkeit, der Männlichkeitswahn. Da gibt es zwischen Rechtsradikalen und Islamisten eine große Ähnlichkeit.
Ist eine restriktive Sexualmoral in den Familien dieser Leute ein Grund für dieses Verhalten?
Lohlker: Vielleicht auch eine zu wenig restriktive. Das heißt, ich breche aus diesem regellosen Leben aus und suche mir ein geordnetes. Hier geht es auch um Bekehrung: Ich habe dieses oder jenes gemacht, aber jetzt bin ich frei davon. Die Propaganda des IS ging in diese Richtung: Wir sorgen dafür, dass eure Frauen geschützt sind, eure Töchter nicht auf Abwege geraten.
Wie sehen Sie die Debatte um die Mohammed-Karikaturen? Sollte man die Zeichnungen veröffentlichen?
Lohlker: Das muss möglich sein, ja. Aber man sollte sie gescheiter einbetten und jenen Muslimen, die sich darüber empören, zu verstehen geben: Ihr könnt auf die Straße gehen, böse Briefe schreiben, öffentlich euren Unmut bekunden. Das wiederum ist nur deshalb möglich, weil es auch solche Karikaturen geben darf. Ergo: Meinungsfreiheit ist die Voraussetzung dafür, dass diese religiösen Standpunkte überhaupt erlaubt sind.
Kujtim F. schaffte es nicht bis nach Syrien, andere schon. Sie alle kommen, wenn sie zurückkehren, ins Gefängnis. Dort werden sie erst recht radikalisiert.
Lohlker: Es gibt durchaus Beispiele, dass Menschen im Gefängnis deradikalisiert wurden. Ein Videoprojekt, bei dem ich mitgearbeitet habe, wurde von einem jungen Mann angestoßen, der auf dem Weg nach Syrien in Ungarn abgefangen wurde. Er hat in Haft zu lesen begonnen und eine Kritik des dschihadistischen Denkens verfasst. Er wurde von Gefängnisimamen und von Jugendarbeitern unterstützt. An dem Projekt waren junge Menschen aus Wien beteiligt, die dschihadistische Neigungen hatten. In den Videos haben sie etwa erklärt: Unser Rekrutierer hat immer diesen Vers zitiert, aber jetzt habe ich weitergelesen. Da kommt was ganz anderes dabei heraus. Man kann ansetzen.
Wie funktionieren die viel zitierten Deradikalisierungsprogramme? Ist das eine Art Psychotherapie?
Lohlker: Das wäre schön, ist aber nicht leistbar. Es werden Gespräche über religiöse Vorstellungen geführt. Es wird die Auseinandersetzung gesucht, versucht, die Gefangenen zu überzeugen, dass ihre Weltsicht nicht als islamisch zu qualifizieren ist, dass es auch andere Weltsichten gibt. Doch Vereine wie Derad, die diese Programme durchführen, sind unterfinanziert. Jeder Haftentlassene bräuchte eine Person, die nicht nur einmal im Monat für ihn da ist, sondern gewissermaßen jeden Tag Mentoring betreibt. Wir müssen mehr machen. Sonst müssen wir sehr viel Geld ausgeben, um Polizeieinsätze zu finanzieren. Für die Gesellschaft würde es sich auszahlen. Leider kann man jene Anschläge nicht zählen, die nicht stattgefunden haben.
In den nächsten Jahren werden viele IS-Rückkehrer aus dem Gefängnis entlassen. Wie sollen wir damit umgehen?
Lohlker: Der Anschlag in Wien führt hoffentlich dazu, dass diese Menschen stärker beobachtet und begleitet werden. Auch die Behörden müssen besser zusammenarbeiten. Wenn ich als Jugendarbeiter merke, dass mein Klient immer stärker in Richtung Dschihadismus abdriftet, muss ich zur Polizei gehen können. Ich muss wissen, ob eine religiöse Begleitung sinnvoll ist. Wie kriege ich so jemanden in eine Lehrstelle? Kann ich noch jemanden von der Familie kontaktieren? Solche jungen Männer haben oft noch Kontakt zur Mutter, nicht zum Vater. Alle müssen zusammenarbeiten, um diese jungen Leute einzufangen. Wenn wir uns das zumuten, dann sind wir einen Schritt weiter in Richtung einer humanen Gesellschaft.
Heinrich Böll hat über die RAF gesagt: „Es sind unsere Kinder.“
Lohlker: Man könnte sagen, der IS stiehlt unsere Kinder. Nehmen wir es endlich wahr!
Man könnte aber auch sagen, dass man damit den Tätern die Verantwortung abnimmt.
Lohlker: Ich denke nicht. Es stimmt, dass es Leute gibt, bei denen jegliche Form von Deradikalisierung keinen Zweck hat. Schlicht und ergreifend. Gegen manches Brett vor dem Kopf kommt man einfach nicht an. Da müssen wir uns überlegen, was mit diesen Menschen geschehen soll. Das ist eine große Problematik in ganz Europa. Ich habe keine Lösung, ich gebe es zu. Ich möchte aber betonen, dass die Deradikalisierungsprogramme aktuell nicht bedeuten, dass man die jungen Menschen wie arme Hascherln behandelt und ihnen sagt: Ich bin ganz lieb und ich glaube, dass du auch ganz lieb bist. Nein. Man sagt ihnen: Du bist offensichtlich jemand, der sich anschauen kann, wie Leute massakriert werden, ohne dass dir das Frühstück hochkommt. Glaub mir, ich trau dir nicht.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: