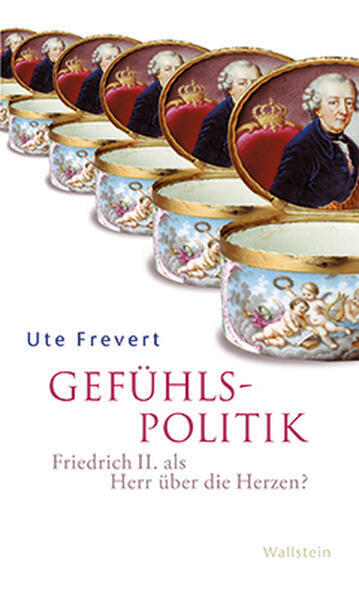Je sens, donc je suis: Ich fühle, also bin ich
Sebastian Kiefer in FALTER 11/2012 vom 14.03.2012 (S. 41)
Geschichte: Vor 300 Jahren wurde Friedrich II. geboren – und die Gefühlspolitik, sagt Ute Frevert
Bismarck beklagte die Schwäche der Deutschen für "Gefühlspolitik" und dachte dabei zuerst an Friedrich Wilhelm IV., den "Romantiker" auf Preußens Thron. Der pflegte sein Gottesgnadentum, setzte con passione neugotische Schlösser und andere Plaisierchen in die Welt, reagierte jedoch planlos auf die Forderungen der 1848er-Bewegung. Der Gegentypus dazu wollte selbstredend Bismarck selbst sein, der ein einziges Ziel, Einigung und Aufstieg Deutschlands unter preußischer Führung, mit eiserner Hand, List und Kalkül planmäßig realisierte.
Eine solche Dualität ist natürlich selbst bloß rhetorisch, denn Politik bedeutet seit je Mobilisieren und Kanalisieren von Leidenschaften, eine Balance von Verheißung und Drohung. Diese Einsicht stand am Beginn Europas und der Demokratie, bei den alten Griechen. Gerade die "Nation" war zu Bismarcks Zeiten eine Massen mobilisierende Ersatzreligion: "Volk", Kampf und Fortschritt, kultisch aufgeladen.
Wenn Ute Frevert, vielfach geehrte Historikerin, derzeit am Berliner Max-Planck-Institut für den Bereich Geschichte der Gefühle zuständig, das Wort "Gefühlspolitik" als neue Kategorie einführen will, argwöhnt man daher zunächst, eine alte Sache solle nur neu etikettiert werden, zumal schon Michel de Montaigne (1533–92) vom Monarchen verlangte, er solle sich Verehrung und Zuneigung durch tugendhaftes Vertreten der öffentlichen Ordnung zuallererst verdienen.
Der Verdacht wird nicht geringer, wenn Frevert ihre Kategorie illustriert mit Willy Brandts legendärem Kniefall vor dem Warschauer-Ghetto-Denkmal von 1970 und den ebenso filmreif inszenierten emotionalen Gesten eines Wladimir Putin, der nach der Flugzeugkatastrophe von Smolensk 2010 seinen polnischen Amtskollegen umarmte.
Diese Aktionen waren im Detail auf moderne Massenmedien zugeschnitten, standen jedoch deutlich in alten Traditionen der Herrschaftsinszenierung, bei Brandt sogar ganz bewusst. Doch Frevert kann einige Indizien für einen Wandel der Emotionalisierung von Politik aufbieten: Im 18. Jahrhundert begann man das Verhältnis von Volk und Regent in Kategorien der persönlichen "Liebe" zu beschreiben, wobei man zwischen "freier" und "erzwungener" Liebe unterschied.
Mitleid, Menschlichkeit, Redlichkeit sollten nun nicht mehr bloß dargestellt, sondern "authentisch" vom Regentenindividuum vorgelebt werden. Monarchen mischten sich unters Volk, forderten Austausch, nicht passive Knechtschaft und Anbetung. Das Volk wollte und sollte nun Anteil nehmen an einem Menschen auf dem Thron, an seinen individuellen Stärken und Schwächen, Charakterzügen, Irrtümern und Schicksalsschlägen. Man ergoss sein Herz und vergoss fortan öffentlich Tränen, Regenten wie liebende Untertanen, Dichter zumal.
Dass Frevert diesen Paradigmenwechsel am Beispiel Friedrichs II. illustrieren will, ist einesteils eher zufällig: Preußen feierte im Jänner den 300. Geburtstag seines Lieblingsmonarchen, den Intellektuelle wegen seiner Freigeisterei und Musenliebe lieben, Patrioten ehren, weil er Preußen im Gespann der rivalisierenden Großmächte Russland, Frankreich, England und des Hauses Habsburg mit einer machiavellistischen Eroberungs- und Bündnispolitik als eigene Macht etablieren konnte.
Andernteils drängt sich Friedrich als Demonstrationsobjekt auf, denn er folgte in vielem noch den alten Repräsentationsformen der Herrschaft, schämte sich jedoch der Tränen nicht und hielt sich mit dem Marquis d'Argens jenen Philosophen im Haus, der dem Zeitgeist sein anticartesisches Credo lieferte: "Je sens, donc je suis."
Heute gehört es zum Standard der Geschichtsschreibung, die Ungleichzeitigkeiten und Widersprüche Friedrichs II. zu betonen: Der Aufklärer und Philosoph auf dem Thron brach mit der Besetzung Schlesiens (1740–42) alle Regeln im Reich, löste mit der Okkupation Sachsens 1756 einen der blutigsten Kriege Europas im 18. Jahrhundert aus, in dem Preußen nur durch eine Verkettung von Zufällen dem Untergang entging.
Er zwang Menschen mit barbarischen Methoden zum Heeresdienst und verkehrte mit ihnen im Felde per du. Er gab den väterlich verstehenden Volksfreund und opferte mitleidlos Menschen. Dies alles findet sich in der neuen rororo-Monografie von Ewald Frie, jedoch in Form einzelner Problemskizzen, verzettelt in Details, sodass kein plastisches Bild der Gestalt Friedrichs II. entsteht. Wer ein solches sucht und nicht zum umfangreicheren Standardwerk von Johannes Kunisch ("Friedrich der Große", 2004) greifen will, ist mit dem teils zwar veralteten, dafür aber farbig, frisch und anekdotenreich erzählten rororo-Vorgängerband von Georg Holmsten besser dran.