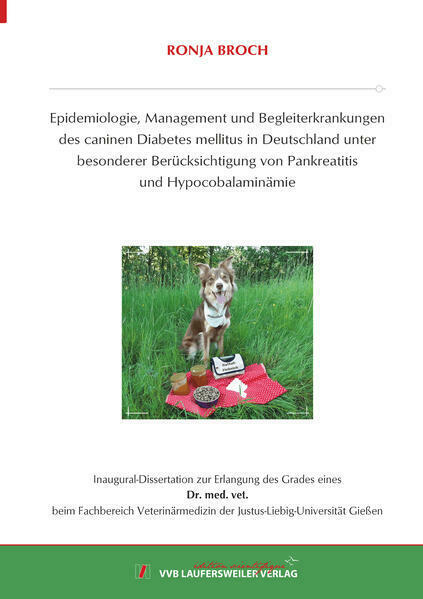Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Reihe | Edition Scientifique |
|---|---|
| ISBN | 9783835971912 |
| Erscheinungsdatum | 23.05.2024 |
| Genre | Medizin/Veterinärmedizin |
| Verlag | VVB Laufersweiler Verlag |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
- ✔ kostenlose Lieferung innerhalb Österreichs ab € 35,–
- ✔ über 1,5 Mio. Bücher, DVDs & CDs im Angebot
- ✔ alle FALTER-Produkte und Abos, nur hier!
- ✔ hohe Sicherheit durch SSL-Verschlüsselung (RSA 4096 bit)
- ✔ keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
- ✔ als 100% österreichisches Unternehmen liefern wir innerhalb Österreichs mit der Österreichischen Post
Hintergrund und Ziele der Studie
Obwohl Diabetes mellitus (DM) eine häufige Endokrinopathie bei Hunden ist, gibt es bisher wenig Studien über Laborparameter bei Diabetikern, sodass diese Angaben derzeit vor allem aus Lehrbüchern stammen. Auch zur Epidemiologie und zum Management der Erkrankung ist nur wenig Literatur verfügbar, wobei diese Aspekte bei caninen Diabetikern in Deutschland bislang gar nicht beschrieben wurden. Ziel dieser Studie war daher die retrospektive Analyse von Abweichungen bei Laborparametern und Erfassung epidemiologischer Daten sowie die prospektive Untersuchung von bei diabetischen Hunden in Deutschland eingesetzten Therapie- und Monitoringoptionen. Dieses Wissen kann helfen, das Management diabetischer Hunde vor Ort zu verbessern.
Material und Methoden
Retrospektiv wurden 145072 Datensätze des kommerziellen tiermedizinischen Labors SYNLAB Vet im Einsendezeitraum von 2015 bis 2018 ausgewertet. Hierbei erfolgte anhand des Fruktosaminwerts eine Unterteilung in diabetische (≥ 370 µmol/l) und nicht-diabetische sowie weiterführend in gut (370 – 450 µmol/l) und schlecht eingestellte diabetische Hunde (> 450 µmol/l). Es wurden epidemiologische Daten (Prävalenz, Alter, Geschlecht und Kastrationsverhältnisse) ermittelt und ausgewählte Laborparameter des geriatrischen Profils (Hämatologie, klinische Chemie, Gesamtthyroxin) zwischen den Gruppen verglichen. Hierbei wurden nicht parametrische Tests und Effektstärkemaße verwendet, um die Relevanz der identifizierten Differenzen zu untersuchen.
Prospektiv wurden in einem Zeitraum von April 2021 bis Dezember 2022 neben Laborparametern (DGGR-Lipase und Vitamin B12 sowie die bereits ausgewählten Laborparameter des geriatrischen Profils) auch Angaben aus Fragebögen zum Signalement und medizinischen Management von 54 diabetischen Hunden in Deutschland ausgewertet. Hierbei konnten weitere epidemiologische Parameter (Alter bei Diagnosestellung, Rasseverteilung, Ernährungszustand und Vorkommen von Saisonalitäten bei der Diagnosestellung des DM) und Faktoren des Monitorings sowie der Therapie (Fütterungsmodalitäten, Insulintherapie, Einstellungsqualität, aufgetretene Begleiterkrankungen und Komplikationen) analysiert werden.
Ergebnisse
Die Prävalenz für caninen DM lag in der Studienpopulation bei 5,12 % (Konfidenzintervall 5,01 – 5,24 %). Im retrospektiven Datenbestand war das mediane Alter von Diabetikern 9 (1. – 3. Quartil: 6 – 12) Jahre. Bei den prospektiv betrachteten Hunden lag das mediane Alter zum Zeitpunkt der Studienteilnahme bei 10 (1. – 3. Quartil: 8 – 12) und zum Diagnosezeitpunkt bei 9 (1. – 3. Quartil: 7,8 – 10,7) Jahren. Männlich intakte bzw. weiblich intakte Hunde waren retrospektiv signifikant häufiger diabetisch als männlich kastriert bzw. weiblich kastrierte Hunde (p < 0,001), jedoch war der Unterschied in beiden Fällen nicht relevant (jeweils Cramér V = 0,026). Nach Mischlingshunden (18/50; 36 %), stellten Terrier (9/30; 30 %) prospektiv die am häufigsten betroffene Hundegruppe dar. Diabetiker waren prospektiv vorwiegend normalgewichtig (21/49; 43 % mit Body-Condition-Score 4 – 5/9) und das mediane Gewicht lag bei 11,7 kg (7,3 – 22,5 kg) (N: 47). Die Diagnose wurde am häufigsten im Winter gestellt (18/47; 38 % im Dezember-Februar), wohingegen dies bei weiblich intakten Diabetikern vor allem im Frühling war (4/7; 57 % im März – Mai). Prospektiv wurden die meisten Diabetiker bereits 1 – 6 Monate (16/53; 30 %) mit Insulin behandelt und Caninsulin (MSD Animal Health) (35/42; 83 %) stellte das am häufigsten eingesetzte Insulinpräparat dar. Die mediane Insulindosis lag bei 1,0 IE/kg/Tag (0,7 – 1,4 IE/kg/Tag), wobei die Diabetiker überwiegend schlecht eingestellt waren (39/51; 76,5% laut Fragebogen). Es gab keinen signifikanten Unterschied (p = 0,121) zwischen der Beurteilung der Einstellung anhand von Fruktosaminwerten (bei einem Grenzwert > 450 µmol/l) und anhand des Fragebogens. Eine diabetische Diät wurde nur bei 58 % (31/53) der Diabetiker eingesetzt und generell erfolgte die Fütterung überwiegend zweimal täglich (44/53; 83 %). Zur Einstellung der Insulintherapie wurde am häufigsten eine Fruktosaminmessung eingesetzt (27/49; 55 %) und bei 49 % (24/49) der Diabetiker wurde mehr als ein Parameter hierfür verwendet. Zur Beurteilung einer schlechten Einstellung wurde überwiegend (30/38; 79 %) mehr als ein Kriterium herangezogen, wobei Polyurie und Polydipsie mit 66 % (25/38) am häufigsten genannt wurde. Komplikationen traten bei 50 % (27/54) der Diabetiker auf und diabetische Katarakt (18/54; 33 %) kam am häufigsten vor. Auch Begleiterkrankungen (29/54; 54 %), vor allem die Pankreatitis (14/54; 26 %), kamen häufig vor. Gastrointestinale Symptome (ohne Gewichtsverlust) traten bei 10/54 (19 %) Diabetikern auf.
Bei der Analyse der retrospektiven Laborparameter stellte eine erhöhte Alkalische Phosphatase (AP) (p < 0,001; r = 0,405 für die absoluten Werte; fünffach erhöhten AP mit p < 0,001 und Cramér V = 0,257) bei schlecht eingestellten Diabetikern den relevantesten Befund dar. Eine erhöhte DGGR-Lipase > 213 U/l kam prospektiv bei 24,5 % (13/53) und ein Cobalaminwert im substitutionswürdigen Bereich < 295 pmol/l bei 9,6 % (5/52) der Diabetiker vor.
Schlussfolgerungen
Die hier ermittelte Prävalenz ist vermutlich höher, als die Prävalenz in der gesamtdeutschen Hundepopulation, da die Studienpopulation nur aus Hunden, die zur Blutentnahme beim Tierarzt vorgestellt wurden, besteht. Bei den untersuchten Populationen konnten Diabetiker in die Gruppe der mittelalten Hunde eingeordnet werden und trotz leichter Tendenzen zwischen den Kastrationszuständen bei gleichem Geschlecht, konnte keine signifikante Geschlechterprädisposition oder relevante Kastrationsprädisposition abgeleitet werden. Die Therapie entspricht in Bezug auf das Insulin- und Fütterungsmanagement größtenteils den allgemeinen Empfehlungen. Die relativ häufige Verwendung von Fruktosaminwerten zur Anpassung der Insulindosis, noch vor der Durchführung von BZTP, bieten jedoch noch einen Ansatzpunkt für Verbesserungen. Da die Aktivität der AP zwischen gut und schlecht eingestellten Diabetikern klinisch relevante und signifikante Unterschiede aufwies, könnte bei Erhöhung dieses Laborparameters bei vermeintlich gut eingestellten Diabetikern eine erneute Überprüfung der Einstellungsqualität in Erwägung gezogen werden.
Diese Arbeit stellt eine Erstveröffentlichung von epidemiologischen und labordiagnostischen Daten diabetischer Hunde aus Deutschland dar und bietet somit eine Grundlage, für gezielt auf die Situation in deutschen Tierarztpraxen ausgelegte Empfehlungen und Weiterentwicklungen im Monitoring sowie der Behandlung des caninen Diabetes mellitus.
| Reihe | Edition Scientifique |
|---|---|
| ISBN | 9783835971912 |
| Erscheinungsdatum | 23.05.2024 |
| Genre | Medizin/Veterinärmedizin |
| Verlag | VVB Laufersweiler Verlag |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
- ✔ kostenlose Lieferung innerhalb Österreichs ab € 35,–
- ✔ über 1,5 Mio. Bücher, DVDs & CDs im Angebot
- ✔ alle FALTER-Produkte und Abos, nur hier!
- ✔ hohe Sicherheit durch SSL-Verschlüsselung (RSA 4096 bit)
- ✔ keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
- ✔ als 100% österreichisches Unternehmen liefern wir innerhalb Österreichs mit der Österreichischen Post
Wie gefällt Ihnen unser Shop?