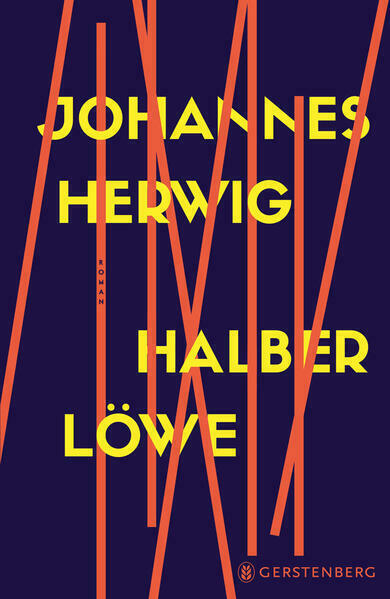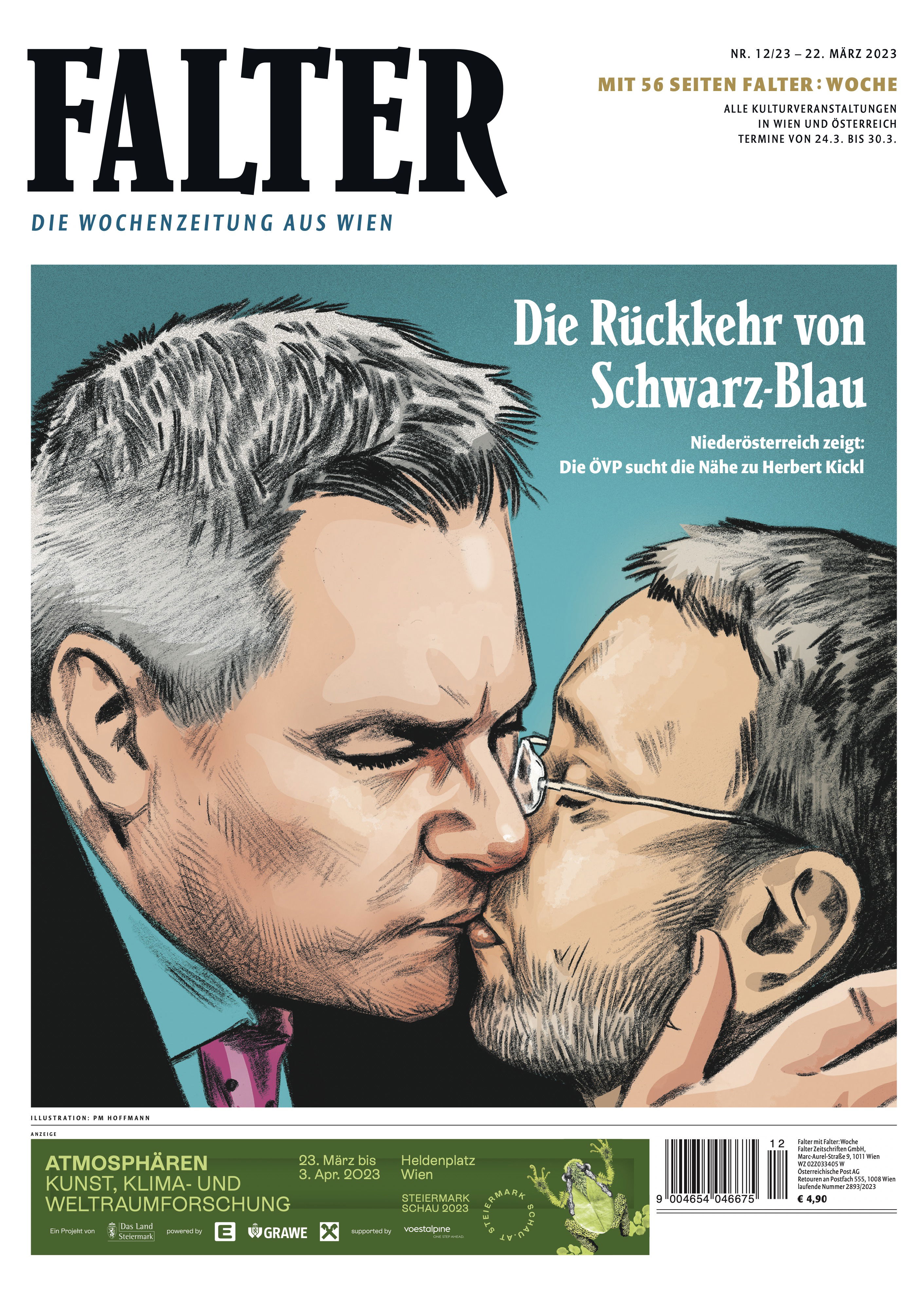
„Wir müssen klarkommen. Irgendwie.“
Kirstin Breitenfellner in FALTER 12/2023 vom 22.03.2023 (S. 25)
In seiner Freizeit lungert der 16-jährige Sascha mit seinen Freunden Timo, Jarno und Engel in einem Abbruchhaus herum. Es fließt viel Bier, Joints machen die Runde, und um sich ihrer Freundschaft als würdig zu erweisen, muss jeder der vier regelmäßig eine Mutprobe bestehen. Sascha etwa soll eine Rauchbombe im Papierkorb des Schulhofs zünden. Die Sache geht glimpflich aus, aber die „Aufgaben“, die die Freunde füreinander erfinden, werden zusehends waghalsiger.
Bei Sascha zuhause sieht es ganz anders aus. Wenn seine Mutter, eine Krankenschwester, ihre Schichten hat, muss er sich um seine kleine Schwester Jacky kümmern. Hier mutiert der Pubertierende zur nicht einmal unwilligen, fürsorglichen Aufsichtsperson. Von Jackys Vater lebt die Mutter getrennt, Saschas Vater starb bei einem Autounfall, als dieser zwei Jahre alt war. Wir sind in den 1990er-Jahren, Schauplatz ist eine ostdeutsche Stadt. Aber diese spannende Geschichte könnte an vielen Orten spielen.
Das Sprachniveau und das Reflexionsvermögen des jugendlichen Icherzählers Sascha scheinen zunächst etwas hoch gegriffen, erst zum Schluss begreift man, dass Sascha seine Geschichte nach einem gewissen Abstand, sich selbst reflektierend, in Worte zu fassen versucht. Und das ist angesichts der verstörenden Ereignisse gar nicht so leicht.
Als ob Sascha nicht so schon genug Schatten auf seinem Herzen zu ertragen hätte, haben er und seine Freunde im Laufe der Handlung einen dramatischen Verlust zu verarbeiten, von dem sie nicht wissen, ob er auf ihre Kappe geht. Das hat mit einem neuen Mitschüler namens Marcel zu tun, einem schweigsamen Jungen, den Sascha in die Gruppe zu integrieren versucht. „Nichts, aber auch gar nichts war noch gültig“, scheint es Sascha danach. Er fällt in ein schwarzes Loch aus Ohnmacht und Zorn.
Dass er dort wieder herausfindet, hat auch mit seiner guten Beziehung zu seiner Mutter zu tun, einer Figur, die schwer schuftet und gerne viel Bier trinkt, aber das Herz am rechten Fleck hat und ihrem Sohn die notwendige Geduld und Unterstützung zukommen lässt. Damit demonstriert der vielfach ausgezeichnete Autor Johannes Herwig, dass auch Familien in einer nicht klassischen Konstellation und ökonomisch unkomfortablen Situationen für die Probleme ihrer Kinder da sein können.
In seinem dritten Jugendroman gelingt es Johannes Herwig – der ebenfalls im deutschen Osten aufgewachsen ist –, eine teils atemberaubende Geschichte zu erzählen und die ihr zugrundeliegenden Lebensthemen auf unaufdringliche Weise mitzureflektieren. „Alle sahen mich an und ich spürte, dass etwas vorbei war. Nicht mehr in Ordnung gebracht werden konnte. Wir waren irgendwo falsch abgebogen“, denkt Sascha nach dem Unglück. Er hatte erwartet, dass die Zeit, wie es so schön heißt, alle Wunden heilen würde, begreift aber, dass das nicht stimmt. „Dass es Wunden gab, die blieben, und dass man diese Verletzungen mit Vorsicht behandeln musste, wenn man mit ihnen weiterleben wollte.“ Er lernt, dass es unmöglich ist, die Geschichte mit Marcel ungeschehen zu machen.
Und er ist nun bereit, sich auch mit dem Tod seines Vaters auseinanderzusetzen, an dem der an dem Unfall beteiligte Lenker schuld war. Verlust, Verantwortung und Vergebung bilden den Basso continuo der hier versammelten Handlungsstränge.
„Wir müssen klarkommen. Irgendwie.“ Mit dieser realistischen Botschaft setzt sich dieses gut zu lesende, poetische Buch wohltuend vom Anspruch so mancher pädagogisch wohlmeinender Jugendliteratur ab, die glaubt, für alles eine Lösung bieten zu müssen.