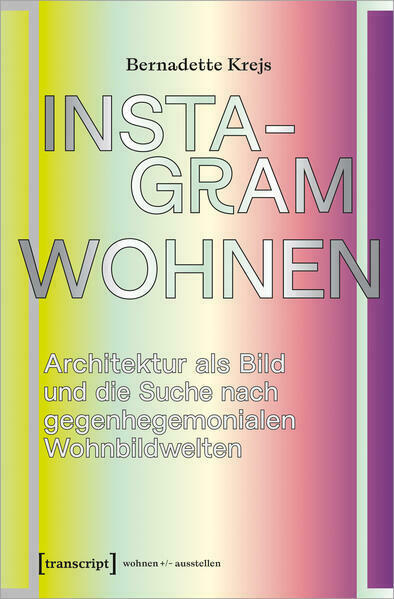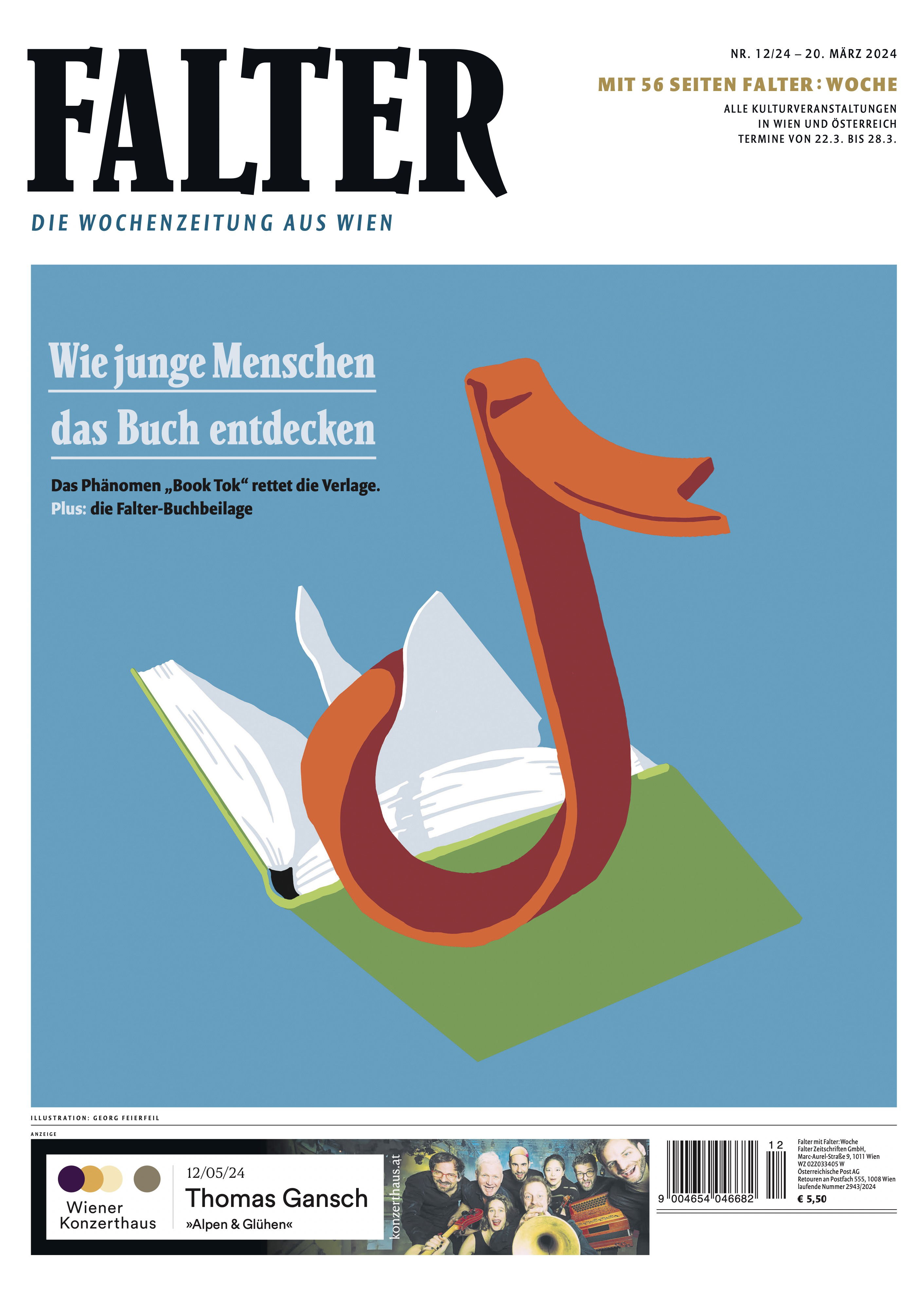
Eine Welt aus Beige
Maik Novotny in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 37)
Erin Vogelpohl aus Dallas, Texas, dekoriert die Seifenspender im Gästebadezimmer mit Schleifchen, sie arrangiert eine gefühlt dreistellige Anzahl von weißen und beigefarbenen Pölstern auf weißen und beigefarbenen Sitzmöbeln. Dann gönnt sie sich „a moment of relaxation“: Foto mit hochgelegten Füßen. Vogelpohl dokumentiert all dies auf ihrem Instagram-Kanal @mytexashouse, eine Million Follower schauen ihr dabei zu. Auch sich selbst inszeniert die Mutter von drei Kindern im Feed und in der Story, stets passend zur Wohnungseinrichtung gestylt. Die Influencerin ist creator und Produkt zugleich. Dank der lukrativen Kooperation mit Walmart ist sie erfolgreiche Unternehmerin, so erfolgreich, dass das Haus, das ihr als Motiv dient, so oft umdekoriert werden muss, dass es inzwischen gar nicht mehr bewohnbar ist. Sie und ihre Familie wohnen woanders, das bisherige Heim ist zum reinen Bühnenbild geworden.
Der Account @mytexashouse ist ein Beispiel, wie der private Innenraum zum öffentlich inszenierten und vermarkteten Schauplatz des Wohnens geworden ist. Eine Welt des perfekten Beige, der Marie Kondos und der Selbstoptimierung. Bernadette Krejs, die an der TU Wien im Fachbereich Wohnbau und Entwerfen lehrt und forscht, hat sich in ihrer Dissertation diesem Thema gewidmet, jetzt ist diese in Buchform erschienen. Krejs ist nicht nur Expertin für Wohnbau, sondern auch Mitglied des feministischen Architekturkollektivs claiming*spaces und inszenierte letztes Jahr mit Max Utech unter dem Titel „Palace of Unlearning: Glitching Mies“ eine Queering-Performance in einer der Ikonen der Moderne, dem Barcelona-Pavillon von Ludwig Mies van der Rohe.
Einen feministisch grundierten kritischen Blick auf Hegemonien bringt sie auch in ihre Analyse von Instagram mit, doch zunächst steckt sie – schließlich handelt es sich um eine Forschungsarbeit – das Untersuchungsfeld weit ab. Die Geschichte der Architektur war schließlich schon immer eng mit der Repräsentation durch Bilder verknüpft, und bereits Le Corbusier und Mies van der Rohe setzten Fotografie und Zeichnung gezielt ein, um für ihre Ideen zu werben. Heute sind es die immergleichen Renderings von glücklichen, meist weißen Kernfamilien zwischen meist weißen Fassaden, die die Bildwelt des Wiener Wohnbaus dominieren. Parallel dazu verläuft die Tradition von massenwirksamen Zeitschriften wie Schöner Wohnen oder den IKEA-Katalogen, die das jeweilige ideal, wer wie zu wohnen habe, unter die Leute brachten. Instagram bringt zwar die Algorithmen als neue Regeln ins Spiel, doch funktioniert es ganz ähnlich. Krejs nennt die vorherrschende Bildästhetik „Instagramism“, sie zeigt sich in den weltweit identischen Interieurs von Airbnb-Wohnungen und im klinisch reinen Weiß-Beige von @mytexashouse und vielen anderen.
Ist dies ein Problem? Ja, so die Autorin, denn hier würden oft konservative Wohn- und Rollenbilder reproduziert, und alles außerhalb der Wohnung – Stadt, Quartier, Nachbarn – bleibe komplett ausgeblendet. Lässt sich etwas dagegen ausrichten? Krejs zeigt einige Beispiele (darunter auch eigene) für andere Wohn-Bilder, die ermutigend subversiv sind und andere Haltungen symbolisieren: etwa die psychedelisch anmutenden bonbonbunten Architekturwelten des Accounts @abnormal_story.
Im abschließenden Urteil, was die Chancen auf einen Sieg des privat-politischen „Wohnens als Widerstand“ betrifft, bleibt die Autorin aber realistisch: „Das Unterfangen, mehr Sichtbarkeit für gegenhegemoniale Bildwelten auf den großen Plattformen zu erzeugen, erscheint (fast) aussichtslos.“ Die Revolution mag auf dem Feld der Algorithmen nicht erfolgreich sein, doch ist „Instagram-Wohnen“ eine bei aller Wissenschaftlichkeit gut lesbare Handreichung für eine digital literacy, die dabei hilft, die verführerischen Bilder und die dahinterliegenden Interessen richtig zu lesen. Das ist vielleicht schon die halbe (Wohn-)Miete.