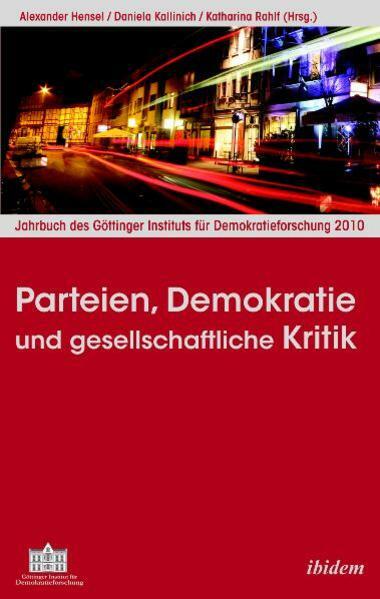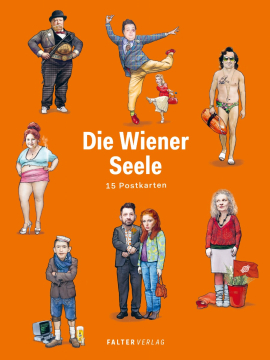Wenn die politische Mitte den Pseudotabubruch träumt
Robert Misik in FALTER 13/2011 vom 30.03.2011 (S. 20)
Ein Band, der vor lauter klugen Analysen überquillt:
das Jahrbuch des Göttinger Instituts für Demokratieforschung
Blogs werden im Internet veröffentlicht, ein Beitrag ist schnell geschrieben und mit einem Klick in die Welt gesetzt. Oft haben sie natürlich auch etwas Flüchtiges. Das Medium Buch ist dagegen so ziemlich das Gegenteil. Bäume müssen gefällt werden, die Texte werden im optimalen Fall mit viel Bedacht geschrieben und redigiert, dann wird gedruckt, gebunden, und dann bringen stinkende Lkw die Bücher zu den Kunden. Hier sei aber etwas empfohlen, was das Medium Blog und das Medium Buch auf das Schönste verbindet. Das Jahrbuch des Göttinger Instituts für Demokratieforschung 2010.
Das Universitätsinstitut unter der Führung des ebenso klugen wie engagierten Professors Franz Walter betreibt nämlich seit einiger Zeit auch ein Weblog. Seminararbeiten und Forschungen von Nachwuchswissenschaftlern verstauben so nicht in den Regalen, sondern werden zu kurzen, pointierten Kommentaren und kleinen, aktuellen Studien verdichtet. Und nun haben die Autoren eben ein Jahrbuch herausgebracht, das über weite Strecken aus den Blogbeiträgen, aus Beiträgen für Zeitungen oder aus eigens für das Jahrbuch verfertigten Stücken besteht. Das Buch quillt förmlich über vor klugen und luziden Analysen über deutsche und europäische Parteien, über die Probleme der Medien- und "Postdemokratie", neue Partizipationsmodelle, Protestkulturen oder die Sprache des Populismus.
Oft erfährt man höchst Erstaunliches, etwa in einem Beitrag Franz Walters, der anhand von Studien zeigt, dass sich heute "in keiner Parteianhängerschaft die Zahl derjenigen, die sich als politisch uninteressiert' bezeichnen, so groß ist wie eben bei den Grünen. Mittlerweile nähert sich der Anteil politisch im Grunde desinteressierter Menschen im Lager der Grünen-Sympathisanten der 50-Prozent-Marke. (...) zu den politisch gefestigten Parteigängern eines ernsthaften ökologischen Entwurfs zählt die Hälfte ihres aktuell vermuteten Elektorats nicht".
Politische Partizipation
Wenn die Grünen in Umfragen hinaufklettern, dann ist das heute oft eine Stilfrage: "Gewissermaßen: Die SPD ist piefig, CDU wirkt gestrig, Linke sind prollig, FDP seit einem Jahr wieder peinlich."
Johanna Klatt untersucht mögliche negative Seiten neuer, partizipativer Demokratiemodelle. "Politische Partizipation war und ist sozial ungleich verteilt. Menschen mit hohem Bildungsgrad und großem Einkommen verfügen stets über stärkere individuelle Ressourcen zum Politikmachen als Einkommens- und Bildungsschwache. (...) Doch strukturelle Veränderungen darin, wie man sich heute politisch beteiligt, werfen die Frage auf, ob bestehende soziale Unterschiede in der politischen Partizipation derzeit nicht sogar zunehmen." Material liefert ihr der Hamburger Schulstreit, bei dem die Bildungsprivilegien der Bessergestellten verteidigt wurden. Hier "stimmten gerade die Bewohner sozial höher gestellter Stadtviertel ab, während Angehörige strukturschwacher Areale den Urnen am Abstimmungstag fernblieben".
Zivilgesellschaftliche Partizipation wird allgemein euphorisch begrüßt, obwohl sichtbar ist, dass hier oft Privilegiertere leichter ihre Stimme erheben können als Unterprivilegierte. Unproblematisch ist das nicht. Man müsse, so Klatt, an die Forderung "Mehr Demokratie wagen" wieder Fragen wie "Für wen?" und "Von wem?" anschließen.
Sprache des Populismus
Lesenswert sind die Gesellschaftsanalysen, etwa jene von Franz Walter über den Gefühlshaushalt der ominösen "gesellschaftlichen Mitte". Diese ist politikverdrossen und "träumt von einer neuen Stunde null". Sie meint, dass vieles nicht gerecht zugeht, aber sie will darauf keine ideologischen Antworten. Die Parteilichkeit mit ihrem Gezänk ist ihr zuwider. "Der politische Held der Mitte wäre derjenige, der deutlich die Probleme dekliniert, der den Vierklang aus Analyse, Lösungsweg, Instrument und Ziel stringent verknüpft und exakt in dieser Schrittfolge vorgeht."
Ein kleines Juwel des Bandes bilden Alexander Hensels Überlegungen über die Sprache des Populismus. Eines dessen zentraler Themen ist ja der behauptete "Tabubruch" gegen die "Politische Korrektheit". Hensel benützt den Begriff des "Pseudotabubruchs", der sich nicht auf real vorhandene Tabus beziehe, "sondern auf zuvor lediglich imaginierte (...). Zunächst wird die eigene politische Position zum Tabu stilisiert. So kann die beschriebene kollektive Ablehnung von Tabus aktiviert werden. Dies ermöglicht, etwaige Kritik der eigenen Position zu diskreditieren, indem diese als bloße Verteidigung des vorgeblichen Tabus beschrieben wird. Als solche kann sie, ungeachtet ihres Inhalts, als Angriff auf Pluralismus und Meinungsfreiheit umgedeutet werden. Der Pseudotabubrecher selbst inszeniert sich demgegenüber als intellektuell redlicher Querdenker und mutiger Verteidiger dieser demokratischen Werte."
Und noch ein Vorteil kommt hinzu: ein inszenierter Tabubruch zieht meist ein hohes Maß an Publizität nach sich, und der Populist kann sich gegen Kritik praktisch immunisieren. Hensels Fazit: "Der Pseudotabubrecher schmückt sich mit Federn, die ihm nicht gebühren: Er ist weder subversiver Märtyrer, aufklärerischer Held noch Verteidiger demokratischer Werte, sondern verfolgt seine politischen Interessen mit Mitteln, die allgemein unredlich sind und den Spielregeln einer demokratischen Öffentlichkeit widersprechen."
Das Jahrbuch selbst ist mit seinen stolzen 82,20 Euro natürlich praktisch unbezahlbar und höchstens für Büchereien eine Option. Aber macht nichts. Man kann es ja entleihen – oder die Mehrzahl der Beiträge einfach im Blog nachlesen.