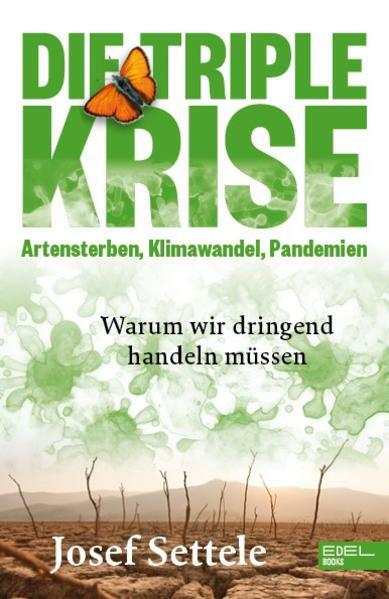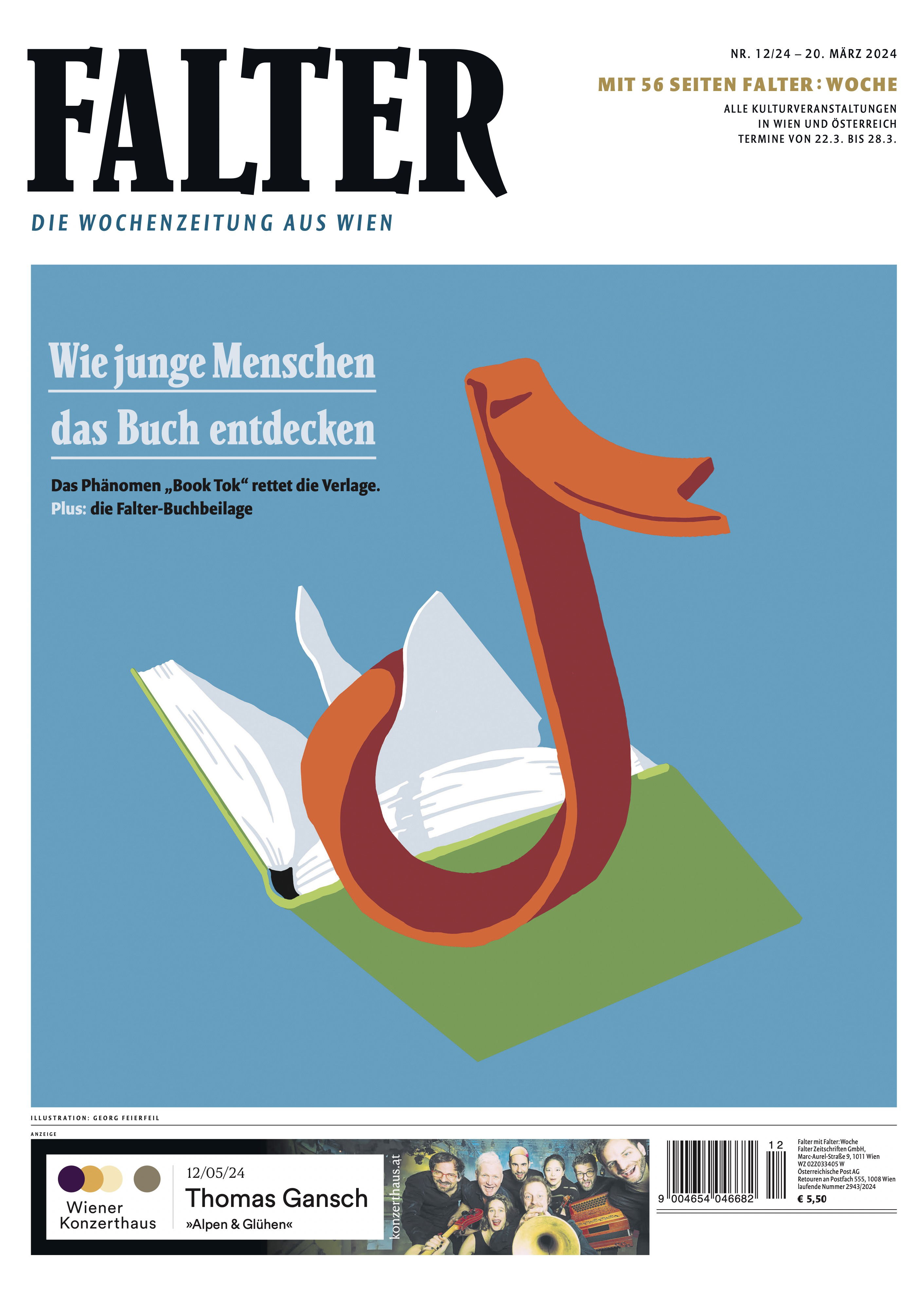
"Der Verstand weicht dem politischen Kalkül"
Benedikt Narodoslawsky in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 43)
Josef Settele ist einer der wichtigsten Biodiversitätsforscher der Welt. Er erklärt, wie kontrollwütige EU-Bürokraten, zornige Bauern und populistische Politiker Europas Natur beeinflussen
Im ehemaligen Kloster von Dürnstein projiziert Josef Settele Fotos von Insekten, Vögeln und Säugetieren auf die Leinwand. "Fast 90 Prozent aller Blütenpflanzen weltweit sind von Tierbestäubung abhängig", erklärt der deutsche Biologe. "Und 75 Prozent der Nutzpflanzen."
Die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich hat internationale Experten in die Wachau geholt, um mit ihnen beim Symposion Dürnstein über die Zukunft der Ernährung zu sprechen. Settele schildert in seinem Vortrag, wie stark das Artensterben die Landwirtschaft -und damit die Ernährungssicherheit -bedroht. Auf der Leinwand im barocken Festsaal präsentiert er nun eine Grafik, darin verläuft eine Kurve steil nach oben. Sie verdeutlicht, wie stark sich das Artensterben in den vergangenen 500 Jahren beschleunigt hat. "Aussterben gab's immer", sagt Settele, "aber die Größenordnung ist heute eine völlig andere."
Nach seinem Vortrag nimmt sich der Biodiversitätsforscher mehr als eine Stunde für ein Gespräch mit dem Falter Zeit. Er warnt darin eindringlich vor dem möglichen Scheitern eines geplanten EU-Gesetzes, das für den europäischen Naturschutz zentral werden könnte und das Bauern, Konservative und Rechtspopulisten gerade vehement bekämpfen -das Nature Restoration Law. Der 25. März könnte zu einem historischen Tag für Europas Artenvielfalt werden.
Falter: Herr Professor Settele, im US-Magazin National Geographic haben Sie gewarnt: "Das lebenswichtige, verwobene Netz des Lebens auf der Erde wird immer kleiner und zerfranst zunehmend." Was meinen Sie damit?
Josef Settele: Dass wir durch den Verlust von Vielfalt immer weniger Arten haben, die die Funktionen in Ökosystemen übernehmen können. Momentan hat jede Art ihre Nische, und diese Nischen überlappen sich noch. Zum Beispiel kommen in England durch den Klimawandel zwei Bestäuber in gewissen Regionen fast nicht mehr vor, die früher häufig waren. Andere Arten, die früher eher selten waren, wurden dafür relevanter und haben deren Nische übernommen. Aber das Netz ist ausgedünnt und nicht mehr so kräftig wie vorher. Wenn immer mehr Arten verschwinden, werden die Ökosysteme irgendwann nicht mehr funktionieren. Wir sind aber auf vielfältige Weise auf Ökosystemleistungen angewiesen. Ein tolles Beispiel dafür ist die Bestäubung, die unsere Ernährung sichert. Wir brauchen ja Obst und Vitamine. Und die Landwirtschaft funktioniert nur, solange die Ökosysteme intakt sind.
Welchen Einfluss hat die Landwirtschaft wiederum auf die Biodiversität?
Settele: Durch die Landwirtschaft verändert sich die Landnutzung, und die veränderte Landnutzung insgesamt ist der Haupttreiber für die Veränderung der Biodiversität weltweit.
Heißt "Veränderung" Verlust?
Settele: In der Masse heißt es Verlust, ja. Auch wenn mancherorts die Biodiversität von der Landwirtschaft auch profitiert hat. Die Kulturlandschaft in Mitteleuropa ist ein Beispiel dafür. Dort hat der Mensch über lange Perioden hinweg neue Systeme kreiert, und die Natur hatte Zeit, sich anzupassen.
So wie unsere Almen, auf denen Bauern dafür sorgen, dass die Wiesen nicht verbuschen. Sie erhalten damit den Lebensraum für Schmetterlinge.
Settele: Ja, genau. Sehr viele von diesen Faltern sind ja über Jahrtausende hinweg eingewandert, zum Teil aus dem mediterranen Raum, einige auch aus Osteuropa. Die sind gekommen und haben sich lokal angepasst.
Über die extensive Landwirtschaft freuen sich die Schmetterlinge also. Wie wirkt sich die intensive Landwirtschaft auf sie aus?
Settele: Die reduziert zunächst einmal die Vielfalt an Pflanzen auf solche, die von der Düngung stark profitieren. Das sind meistens nur ausgewählte Gräser. Alle Pflanzen, die nicht so konkurrenzfähig sind, fallen früher oder später aus. Ganz viele Schmetterlinge leben nicht auf Gräsern, sondern auf krautigen Pflanzen. Sind die Kräuter weg, sind die Falter weg. Aber auch die Gräser bewohnenden Falter haben ein Problem. Intensive Landwirtschaft heißt auch: Ich mähe und nutze die Wiese viel häufiger. Wenn ich eine Wiese fünfmal im Jahr mähe, kann man sich ausmalen, dass kaum ein Insekt einen Zyklus von einer Generation zur nächsten schafft. Die Zeit, die es für die Entwicklung braucht, ist einfach zu lang. Raupen, Eier oder Puppen können ja nicht vor der Mahd fliehen, erst der Falter kann wieder abhauen. Und schließlich gibt es in der intensiven Landwirtschaft auch noch Insektizide. Wer sich wundert, dass Insektizide Insekten töten, hat nicht richtig kapiert, wofür die gut sind.
In der EU sind etwa 80 Prozent der Lebensräume mittlerweile in einem ökologisch schlechten Zustand: Die EU-Kommission hat deshalb die "Verordnung über die Wiederherstellung der Natur" auf den Weg gebracht, das sogenannte Nature Restoration Law. Das EU-Parlament hat es Ende Februar mit hauchdünner Mehrheit abgesegnet. Der EU-Umweltministerrat, in dem die Umweltminister der EU-Mitgliedsstaaten sitzen, muss ihm noch
zustimmen. Wird es noch einmal spannend? Settele: Geplant war die Abstimmung für den 12. April, es hieß ursprünglich, der Rat werde es nur kurz durchwinken. So wie es jetzt aussieht, will er es aber am 25. März noch einmal komplett diskutieren. Für eine Zustimmung braucht es eine qualifizierte Mehrheit, das heißt, die abstimmenden Länder müssen mindestens 65 Prozent der Bevölkerung in der EU repräsentieren. Wir stehen momentan laut unserer letzten Abschätzung nur noch knapp über den 65 Prozent. Wenn sich noch irgendjemand querlegt, wäre das das Ende des ganzen Prozesses. Es steht also Spitz auf Knopf. Weil es sehr eng wird, ist jedes Land wichtig, auch wenn es noch so klein ist. Ungarn hat sich noch nicht final entschieden. Österreich ist ein Wackelkandidat. Wenn sich Österreich enthält, verringert es die Chance, dass das Nature Restoration Law kommt. Am Ende ist ja egal, ob ein Land dagegen stimmt oder sich enthält. Beides zählt als Nichtbefürwortung. Entscheidend ist nur der Anteil der befürwortenden Stimmen.
Was würde die Ablehnung für Europas Natur bedeuten?
Settele: Dass wir viele geplante Fortschritte nicht machen werden. Das Gesetz ist zwar schon verwässert worden, hat aber noch ganz viele Komponenten, die wichtig sind. Etwa die klimagerechte Landnutzung, dazu zählt auch die Wiedervernässung von Mooren. Moore können CO2 speichern und zählen zu den Klassikern in der Kombination von Natur-, Biodiversitäts-und Klimaschutz. Ein anderer wichtiger Punkt im Gesetz ist die Agrarlandschaft, die man durchlässiger gestalten möchte.
Warum ist das wichtig?
Settele: Viele Arten müssen zwischen einzelnen Lebensräumen wechseln, das ist Teil ihrer Überlebensstrategie. Es gibt Agrarlandschaften, die sind bereits reich strukturiert -sie haben zum Beispiel Hecken und Blühstreifen. Diese Elemente vernetzen Lebensräume und sind wichtig für die Arten. Aber wenn ich die Magdeburger Börde bei Halle hernehme, wo ich wohne: Das ist einfach ein großes, breites Ackerland. Jeden Sommer hat es beispielsweise durch Wind mit Erosion zu kämpfen. Reichert man solche Gebiete mit Landschaftselementen wie Hecken und Blühstreifen an, bekommen sie nicht nur einen Windschutz. Sie bieten dann Arten auch die Möglichkeit, die Landschaft zu durchqueren. Sie sind wie Tankstellen. Bienen können dort Nektar tanken.
Das heißt, wenn ein Insekt eine Maiswüste durchquert, kann es sich in einer solchen Oase wieder aufpäppeln, um die nächste Maiswüste zu überwinden.
Settele: Ja. Und je größer die Distanz zu einer solchen Oase ist, umso schwieriger wird es für das Tier.
Das EU-Parlament hat die Verordnung schon stark verwässert. Ist sie noch ihren Namen "Wiederherstellung der Natur" wert?
Settele: Eigentlich müsste es heißen: "Gesetz auf dem Weg zur Wiederherstellung der Natur." Natürlich ist dieser Weg ein bisschen holprig geworden, aber er ist nach wie vor da, und die Richtung stimmt. Hätten wir das Gesetz nicht, wäre kaum mehr etwas von dem übrig, was die Wissenschaft und die Politik zur Nachhaltigkeit der Landnutzung entwickelt haben. Es würde einfach ein ganz großer Baustein - auch wenn er bereits kleiner geworden ist -wegfallen. In der nächsten EU-Legislaturperiode würden wir wieder beim Urschleim zu diskutieren anfangen. Und man kann sich ausmalen, wie die Wahlen ausgehen könnten und wie schwierig es dann wird, ein solches Thema anzugehen.
Ich habe vor wenigen Tagen mit einem sehr wütenden Bauern gesprochen. Er sieht die Verordnung als ein weiteres Bürokratiemonster aus Brüssel. Verstehen Sie ihn? Settele: Ja, es gibt tatsächlich viel Bürokratie. Ganz komische Sachen, die man machen muss und bei denen man denkt: "Was soll denn das jetzt wieder?", erlebt aber jeder von uns, nicht nur die Landwirte.
Sie auch in der Wissenschaft?
Settele: Na klar, zum Beispiel, wenn man eine Reisekostenabrechnung begründen muss, weil man irgendwo noch länger bleiben musste als ursprünglich geplant. Da gibt es einen Haufen Käse, und man bekommt das Gefühl, es gibt kein Vertrauen in die Wissenschaftler, sondern es gibt eine Kontrollwut, die die Jobs für Menschen sichern soll, die für diese Kontrollen zuständig sind. Ich kann also sehr gut verstehen, dass man einfach keinen Bock mehr hat auf Bürokratie. Das Problem ist nur: Mittlerweile wird Bürokratie gleichgesetzt mit Umweltauflagen. Aber erhöhen Umweltauflagen zwangsläufig die Bürokratie? Beim Nature Restoration Law gibt es zum Beispiel einen Index der Wiesenschmetterlinge. Den kann der Landwirt gar nicht berechnen. Der geht natürlich nicht mit dem Käscher raus und sammelt Insekten. Sondern den Index der Wiesenschmetterlinge muss der Nationalstaat erstellen und umsetzen. Das ergibt also nicht zwangsläufig mehr Bürokratie für die Bauern.
Seit Monaten blockieren sie dennoch mit ihren Traktoren die Straßen, kippen Mist auf öffentliche Plätze, machen Druck auf die Politik. Die geplante Pestizid-Verordnung ist bereits geplatzt, die EU-Kommission hat am Freitag bekanntgegeben, dass sie nun auch Umweltauflagen bei den Förderungen wieder zurücknehmen will.
Settele: Das sind politische Reflexe. Dass die Landwirte auf der Straße sind, ist ja eine neue Entwicklung der letzten Monate. Die Politiker versuchen nun, sie auf ihre Seite zu holen. Es geht dabei nicht um sachliche Argumente, sondern um Populismus. Das sieht man an der Brachflächenthematik. Hinter den vier Prozent, die die Landwirte von ihren Äckern als Brachfläche bereitstellen sollten, steckt die Idee, die Landschaft zu verbinden, also einen Biotopverbund zu schaffen. Schon als der Ukrainekrieg losbrach, war in Deutschland der erste Reflex: "Wir müssen ganz dringend zur Sicherung der Welternährung diese Brachflächen wieder in Nutzung nehmen." Dabei sind das ja ohnehin jene Flächen, die für den Landwirt mechanisch am schwersten zu bearbeiten und am schwersten zugänglich sind, die also ohnehin weniger Ertrag haben. Damit lässt sich die Welternährung nicht sichern. Der Elefant im Raum ist, dass wir massiv in Richtung pflanzenbasierte Ernährung kommen. Das ist zwar ein langer Weg, aber da kann ich auch mit kleinen Schritten viel mehr erreichen, als diese vier Prozent Brachflächen zu opfern.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat vor wenigen Tagen ihre Empfehlungen überarbeitet. Sie hat erstmals auch Umweltfaktoren berücksichtigt und empfiehlt für eine gesunde Diät nur noch 300 Gramm Fleisch und ein Ei pro Woche. Tierische Produkte sollen insgesamt nur noch ein Viertel der Ernährung ausmachen. Würde eine solche Ernährungsumstellung die Biodiversität tatsächlich beeinflussen? Settele: Die Ernährung ist für den Erhalt der Biodiversität ganz wichtig, weil sie die Landnutzung beeinflusst. In Deutschland nutzen wir derzeit 60 Prozent der Agrarlandschaft für Viehfutter. Weniger Fleischprodukte würde bedeuten, man hätte mehr Möglichkeiten, diese Flächen auch anders zu nutzen.
Derzeit bekommen jene Bauern am meisten Geld von der EU, die die größten Flächen bewirtschaften. Werden auch jene Bauern gerecht entlohnt, die sich auf ihren Flächen besonders für den Erhalt der Biodiversität einsetzen? Settele: Gemessen an dem, was wir an Gratisleistungen durch die Biodiversität entgegennehmen, ist die Förderung mickrig.
Wie viel bringt uns denn die Biodiversität an Gratisleistungen?
Settele: Wir haben in unserem Team einmal berechnet, wie hoch allein der weltweite Nutzen durch die Bestäubung für uns ist. Auf Basis der Berechnung von 2015 sind es zwischen 250 und 600 Milliarden Euro pro Jahr. Die 250 Milliarden sind das, was wir gratis als Leistung entgegennehmen. Wir haben dabei den Wert von den Produkten berechnet, die bestäubungsabhängig erzeugt werden, und ihn um die Abhängigkeit von der Bestäubung korrigiert. Die 600 Milliarden sind wiederum die Kosten, die wir tragen müssten, wenn wir diesen Service, den uns die Bienchen bieten, ersetzen müssten. Der Homo sapiens hat als Bestäuber ja bekanntermaßen nicht viel Erfahrung und geht dabei eher stümperhaft vor. Die Bestäubung würde uns also viel Zeit und viel Geld für die Arbeitskräfte kosten. Und dabei ist die Bestäubung nur eine von vielen Ökosystemleistungen.
In drei Monaten finden die EU-Wahlen statt. In der aktuellen Periode stand der Green Deal im Mittelpunkt der EU-Politik. Wie bewerten Sie ihn bisher?
Settele: Die Geschichte ging jedenfalls toll los. Wie erfolgreich der Green Deal sein wird, kann ich aber noch schlecht einschätzen, weil momentan gerade sehr vieles verwässert wird. Ein irischer Abgeordneter der Europäischen Volkspartei hat bei einem Treffen vor wenigen Wochen sinngemäß gesagt: "Das könnt ihr jetzt eh vergessen mit der Vernunft! Wir haben jetzt Wahlzeit, da hat jeder sein Gehirn abgeschaltet und guckt nur noch, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt. Wir können uns nach der Wahl wieder über vernünftige Politik unterhalten." Wir sind also in einer Phase, in der Verstand dem politischen Kalkül weicht. Wenn das Nature Restoration Law nächste Woche angenommen wird, haben wir eine wesentliche Komponente des Green Deal erreicht. Wenn es nicht läuft, weiß ich auch nicht, was davon noch übrig bleibt. Dann würde ich sagen: Der Green Deal ist als Tiger losgesprungen und als Bettvorleger gelandet.