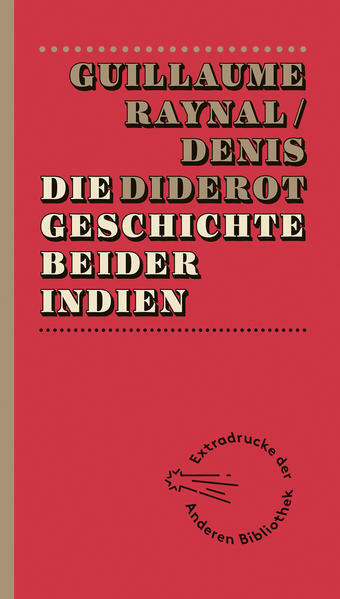Ein avantgardistischer Bonvivant, gefährlich und gefährdet
Armin Thurnher in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 30)
Denis Diderot, Schriftsteller, Aufklärer und Enzyklopädist, ist anlässlich seines 300. Geburtstags neu zu entdecken
Unter den berühmten "philosophes" der Aufklärung ist Denis Diderot wahrscheinlich der am wenigsten Gelesene. Von Goethe bis Enzensberger fehlt es nicht an literarischen Kennern, Übersetzern und Bewunderern, aber einem breiten Publikum ist Diderot bloß ein Name geblieben. Gelesen werden heute – wenn überhaupt – eher die beiden anderen aus dem Dreigestirn der französischen Aufklärung, Rousseau und Voltaire. Aus Anlass des 300. Geburtstags Diderots erscheinen einige Bücher, die hier Abhilfe schaffen sollten.
Wäre man Zeitgenosse gewesen, hätte man zweifellos am liebsten eine Beziehung mit Diderot unterhalten; von den drei Genannten glich er noch am wenigsten einem Monster. Voltaire: ein scharfzüngiger, herrschsüchtiger Großintrigant. Rousseau: ein aufregender Autor und exhibitionistischer Paranoiker. Diderot dagegen: zugleich umgänglicher Bonvivant und Star der Salons, Avantgardist und unauffälliges, zuverlässiges Arbeitstier.
Mit Rousseau verband Diderot eine Freundschaft, die sich – wie alle Freundschaften Rousseaus – nach einem Bruch in Gegnerschaft verwandelte. Diderot war gleich zu Beginn seiner philosophischen Laufbahn einer Publikation wegen verhaftet und ins Gefängnis geworfen worden; Rousseau besuchte ihn dort und empfing auf dem Weg dorthin die Eingebung zur Beantwortung jener akademischen Streitfrage, die Rousseau berühmt machte, ob nämlich die Kultur die Menschen verbessert habe. Die Vision ist die Rousseau'sche Version des Vorfalls. Diderot hingegen berichtet, er habe Rousseau im Gefängnis die Antwort suggeriert. Die Antwort lautete natürlich Nein.
Zum Bruch zwischen beiden kam es aber erst, als Rousseau einen Satz Diderots aus dessen Stück "Der natürliche Sohn" auf sich bezog: "Nur der Einsame ist böse." Der erst durch Goethes Übersetzung bekannt gewordene Aufsatz Diderots über Rameaus Neffen wiederum ist unlängst als gehässig-ironisches Porträt des Freund-Feinds Jean-Jacques Rousseau gelesen worden – eine durchaus mögliche Deutung.
Wir brauchen uns hier nicht mit der Geschichte der Konflikte zwischen Voltaire, Rousseau und Diderot aufzuhalten, alle drei übrigens Autoren der Enzyklopädie, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Die Gefängnisepisode aber ist wichtig, um uns vor Augen zu führen, welchen Mut es brauchte, als Aufklärer in Frankreich, einem absoluten Staat des 18. Jahrhunderts, zu publizieren.
Man muss die Schriften der Aufklärer unter dem Vorbehalt lesen, dass sie nicht in allem offen reden konnten. Eine Erwähnung Gottes bedeutet also nicht unbedingt ein Bekenntnis zur Religion, sondern eher eine Schutzmaßnahme gegen die Zensur. Mindestens so sehr wie auf den Primärtext kam es darauf an, in welche Nachbarschaft man welche Begriffe stellte. Gerade die Enzyklopädie zeigt das deutlich.
Die Verhältnisse schillerten: Der Zensor Lamoignon de Malesherbes zum Beispiel war ein liberaler Mann, der sich durchaus mit den von ihm Zensurierten in Briefwechseln über Maßnahmen unterhielt, verbotene Werke im benachbarten Ausland und in begrenzter Auflage zum Druck zu befördern; sein Vorgänger hatte Diderot noch einsperren lassen. Einmal habe er, heißt es, sogar Diderot vor einer drohenden Hausdurchsuchung gewarnt und dessen Enzyklopädie-Manuskripte bei sich zu Hause versteckt. Prekäre Verhältnisse von Intellektuellen hatten damals nicht nur einen ökonomischen Beigeschmack.
Vom Land nach Paris gekommen, wo er, wie viele seiner Generation, für eine Laufbahn als Kleriker vorgesehen war – er hatte schon die niederen Weihen –, erlebte Diderot als junger Philosoph, wie eine seiner Schriften öffentlich verbrannt wurde und die andere ihm die erwähnte Festungshaft einbrachte. Diese Haft schwebte fortan als Drohung über allem, was er publizierte. Aber sie bedeutete auch Reklame für den Autor Diderot, der fortan berühmt war. Ein zweischneidiger Ruhm, der ihm immer wieder die Flucht in die Anonymität nahelegte.
Das Unternehmen der Enzyklopädie ist vielleicht auch deswegen Diderots Hauptwerk, weil er sich als freistehender Autor nie sicher fühlen konnte. Das soll nicht heißen, seine literarischen Werke wären nicht lesenswert – im Gegenteil! Da wäre etwa der pornografische Roman "Die sprechenden Kleinode", dessen Hauptwitz darin besteht, dass die Geschlechtsteile der Damen in einem afro-asiatischen Staat unter gewissen Umständen beginnen, indiskrete Dinge auszuplaudern und allerhand preiszugeben, was sonst ungesagt bliebe.
Aber der Roman ist unbedeutend, ein Scherz, den Diderot in zwei Wochen aufs Papier warf, um zu zeigen, dass er so etwas auch konnte. Durch Gesellschaftskritik in erotischem Gewand brachte sich der Autor nicht in Gefahr. Das schaffte er mit seinem "Brief über die Blinden, zum Gebrauch für die Sehenden" mit nichts als ein paar Fragen zur Gewissheit wissenschaftlicher Erkenntnis.
In der Haft habe er sich "zum surrealen Romancier" weiterentwickelt, schreibt die Philosophin Ursula Pia Jauch, Kennerin der französischen Aufklärung. In der Tat zeigt der Roman "Jacques le Fataliste", eine Herr-Knecht-Geschichte beinahe Beckett'schen Zuschnitts, einen überaus modernen Autor. Allein der Anfang! "Wie haben sie sich getroffen? Durch Zufall, wie alle Welt. Wie hießen sie? Was spielt es für eine Rolle? Wo kamen sie her? Gleich von nebenan. Wo gingen sie hin? Wer weiß schon, wohin man geht?"
Der Erzähler Diderot ist in einem der nun erschienenen Bücher (Denis Diderot: Vier Erzählungen. Mit einem Nachwort von Karl-Heinz Ott) kennenzulernen, wenn auch nicht zu fixieren. Denn er zieht sich hinter seine Montagen aus Briefen, Dialogen, Berichten von Berichten zurück, sodass sich die Position des allwissenden Erzählers wie von selbst auflöst.
Manchmal hat das Verschwinden des Autors Diderot literarische Gründe, manchmal auch handfeste. Lange Zeit schrieb man das für die Aufklärung äußerst einflussreiche Buch "Die Geschichte beider Indien" dem Abbé Guillaume Raynal zu; die schöne Neuausgabe des bereits vor Jahren in der Anderen Bibliothek erschienenen Werks nennt aber Denis Diderot als Koautor. Raynal sei mehr eine Art Kompilator gewesen, für die politisch-philosophischen Passagen aber war Diderot verantwortlich, berichtet Herausgeber Hans-Jürgen Lüsebrink. Seinen riesigen Einfluss erlangte das Werk wegen seiner expliziten Anklage von Sklaverei und Unterdrückung.
In einem Brief an Friedrich Melchior Grimm, den Herausgeber der einflussreichen Correspondance littéraire, philosophique et critique, verteidigte Diderot Raynals Werk – und wohl auch sich selbst – so: "Und warum hätte denn der Abbé nicht den gemäßigten Ton des Historikers? Weil man unter drei- bis viertausend Seiten vielleicht auch fünfzig Seiten trifft, die von der Begeisterung für die Tugend oder von der Abscheu für das Laster diktiert sind." Fünfzig bis sechzig Seiten, das dürfte den Umfang von Diderots Anteil an Raynals Buch ganz gut treffen.
Das Werk der Werke Diderots war allerdings die Enzyklopädie. Er begründete sie zwar nicht, nahm aber von Anfang an als Herausgeber teil. Die Verleger planten die Enzyklopädie als kaufmännisches Unternehmen; das investierte Kapital und die involvierten Manufakturen schützten das ab 1751 erscheinende Unternehmen tatsächlich vor einigen Eingriffen der Zensur; umgekehrt musste sich Diderot, gemeinsam mit seinem Mitherausgeber, dem Mathematiker und Physiker D'Alembert, gegen interne Zensur wehren. "Sie haben die Arbeit von zwanzig Ehrenmännern massakriert", schrieb er erbost an die Verleger, die wiederum der offiziellen Zensur zuvorkommen wollten. Die Enzyklopädie wurde trotzdem bereits 1752 verboten, aufgrund ihrer ökonomischen Bedeutung aber mithilfe von Ausnahmegenehmigung gedruckt. Am Ende brachte sie ihren Verlegern fette Profite.
Diderots Vater, ein Handwerker, entzog dem Theologiestudenten die finanzielle Unterstützung, als dieser heiratete. Der Sohn fand in der Enzyklopädie Lebensaufgabe und Lebensunterhalt. Er redigierte sie, koordinierte deren weit über 150 Autoren und schrieb selbst etwa 1500 von insgesamt 72.000 Artikeln. Voltaire und Rousseau trugen nur wenige Artikel bei; D'Alembert zog sich wegen der vor und nach dem Druckverbot einsetzenden Hetze gegen die Enzyklopädisten bald zurück und betreute nur noch die Naturwissenschaften. Diderot aber lebte für die und von der Enzyklopädie.
Legendär ist die ökonomische Schlitzohrigkeit Diderots. Er wohnte zwar nur in einer Mansarde, verkaufte aber zum Beispiel der russischen Zarin Katharina II., die er auch beriet, seine Bibliothek, behielt diese aber zur Nutzung und bezog von der Gönnerin dafür gleich noch ein Salär als sein eigener Bibliothekar – das muss ihm erst einer nachmachen.
Die Enzyklopädie versammelte nicht nur das Wissen der Zeit, sie diente der Durchsetzung rationaler Vernunft und unterlief das Diktat der Religion, ohne die sich kein Thron lange halten konnte. Inwiefern die Enzyklopädie tatsächlich jene "Kriegsmaschine der Aufklärung" war, als die sie gerühmt wird, kann man nun an zwei auf Deutsch erschienenen Auszügen überprüfen, an der nüchtern sachlichen Ausgabe des Fischer-Taschenbuchs und an der opulent aufgemachten, mit zahlreichen Originaltafeln versehenen und der Original-Typografie angepassten Ausgabe der Anderen Bibliothek. Kompetent eingeleitet sind sie beide (des Französischen mächtige Fans können auf die Website mit dem Volltext rekurrieren, die man auf fr.wikisource.org findet).
Diderot: ein zugleich bauernschlauer und hocheleganter Autor, ein Geist, der wie kaum ein anderer seine Epoche in mehrfachem Sinn umbrochen hat. Im Schlusswort der "Geschichte beider Indien" formuliert er selbst, worum es ihm ging: "Dies geringe Werk, welches nur das Verdienst haben wird, bessere veranlasst zu haben, wird gewiss vergessen sein; aber wenigstens werde ich zu mir sagen können, dass ich zur Glückseligkeit meiner Nebenmenschen so viel beitrug, als an mir war, und dass ich vielleicht von weitem die Verbesserung ihres Schicksals vorbereitete. Dieser süße Gedanke soll bei mir die Stelle des Ruhms vertreten. Er wird die Freude meines Alters und der Trost meiner letzten Augenblicke sein."
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: