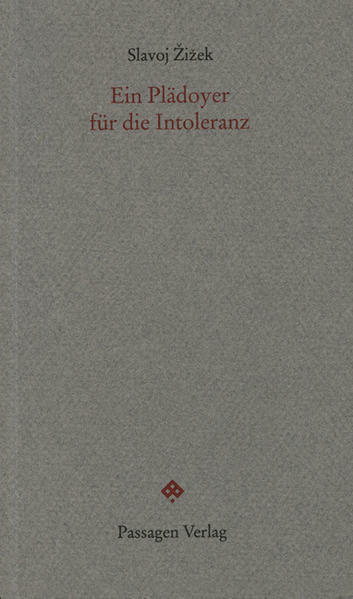Robert Misik in FALTER 32/2003 vom 06.08.2003 (S. 13)
Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek ist ein Weltstar geworden, der die Geister scheidet: Der "Merkur" hält ihn für "geistig verwahrlost", der "New Yorker" fragt sich, ob er ein "Philosoph oder ein Komödiant" ist. Erkundungen über einen global operierenden Philosophie-Entertainer.
Mit Symptomen schlägt sich Slavoj Zizek viel herum. Sie sind die geheimnisvollen Wegmarken, die etwas wirklich sichtbar machen im Meer des allzu offenkundig Sichtbaren, "im Sinne eines zweideutigen Zeichens, das auf einen verborgenen Inhalt verweist", um das mit seinen eigenen Worten zu sagen. Aber was, wenn ..., was wenn Slavoj Zizek selbst in dieser Weise ein Symptom ist? Dass der slowenische Philosoph sich "beinahe schon sagenhaften Ruhmes" erfreut, wie Jörg Lau unlängst im Merkur formulierte, sorgt für zunehmende aggressiv-nervöse Abwehr in Kreisen des soft-links-liberalen Mainstreams, und auch wohlwollendere Beobachter fragen sich, wie zuletzt Rebecca Mead in ihrem zehnseitigen Großporträt im New Yorker über den "international star from Slovenia", ob Zizek gar bloß als linker Intellektueller erscheint, "er in Wahrheit aber ein Komödiant ist".
Was also, wenn Zizeks Ruhm ein Symptom ist für ein simples Unbehagen an der globalen kapitalistischen Kultur? Und für die Hoffnung auf eine Radikalität, die weder altbacken-gutmenschlich, aber doch nicht nur ästhetizistisch ist? Und, dies ebenso, für die Schwierigkeiten, diese Radikalität zu realisieren? Die Frage, so gestellt, führt mitten in die Gedankenwelt Slavoj Zizeks hinein.
Denn das Wortpaar "was, wenn ..." ist die meistgebrauchte Wendung in Zizeks Texten (die auf Englisch geschrieben werden, also: ,what, if...'), sie ist sein Handwerkszeug, markiert aber auch seine Gedankenbewegung. "Was, wenn ..." eröffnet den Horizont zur paradoxen Wendung, manchmal zur absurden Volte, immer zum unerwarteten Widerspruch, auch zum Selbst-Widerspruch. "Was, wenn ..." erlaubt aber auch, sich nicht allzu deutlich festzulegen. "Was, wenn ..." ist die Formel des Experimentellen, wenn man so will die goldene Regel der Feuilletonistischen. Textbausteine, Gedankenbausteine Zizeks - und seine Texte sind allesamt Baustein-Texte - funktionieren im Wesentlichen nach einer Logik: Er entwickelt eine These oder einen Sachverhalt, dessen innere Logik auf eine Deutung hin zurast. Mit "was, wenn ..." kann er einen Haken schlagen und insinuieren, es sei vielleicht das genaue Gegenteil dessen wahr, was der Common Sense annehmen würde. Wobei die "Was, wenn ..."-Logik nicht so weit gehen muss, dieses Gegenteil wirklich und fest zu behaupten.
Der Multikulturalismus beispielsweise ist doch eine schöne, linke Idee. "Was, wenn dieser entpolitisierte Multikulturalismus die Ideologie des derzeitigen globalen Kapitalismus wäre?", fragt Zizek in einem solchen Fall.
Zizek ist hip. Zizeks Auftritte bürgen für volle Säle, ob in Wien, Berlin, London oder New York. Seine Bücher behandeln Themen wie Hitchcock, Lenin, den 11. September, die Oper und sind in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. Er ist vollbärtig, strubbelig, leicht untersetzt und trägt alte Hemden. Er ist, was man ein Ereignis nennt. Wenn er Platz nimmt, um einen Vortrag zu halten, ein Interview zu geben oder bloß ein Gespräch zu führen, erinnert er an das Prinzip des Viertaktmotors auf hohen Touren: regelmäßige, explosionsartige Verbrennung, schnelles Stakkato. Fast hysterisch Gedanken produzierend, sitzt er da, bald schon in einer Pfütze Schweiß. Er spricht in einem unverkennbar osteuropäischen High-Speed-English, macht hier eine konterintuitive Beobachtung, um ihr da seinen favorisierten Argumentationsmodus, das Paradoxon, anzuschließen. "Man muss den manischen Redeschwall seiner Vorträge erleben, die er unter expressiven Gesten hervorstößt, immer ein bisschen beängstigend und charmant zugleich", schreibt Jörg Lau, der keinen Zweifel daran lässt, wie abstoßend er den Kerl findet, der "etwas Verkommenes, geistig Verwahrlostes" an sich habe. Für ihn ist Zizek die vielleicht hässlichste Fratze des Radical Chic, jenes akademisch-radikalen Denkens, das sich in leeren Gesten verliert, diese aber in einer großen Blase fortwährend weiterproduziert. Zizeks Mit-Verdächtige sind aus solcher Sicht Theoretiker wie Judith Butler, Giorgio Agamben, Jean Baudrillard, die Empire-Autoren Toni Negri und Michael Hardt, aber auch Postmarxisten wie Ernesto Laclau, Chantal Mouffe oder Frederic Jameson.
(...)