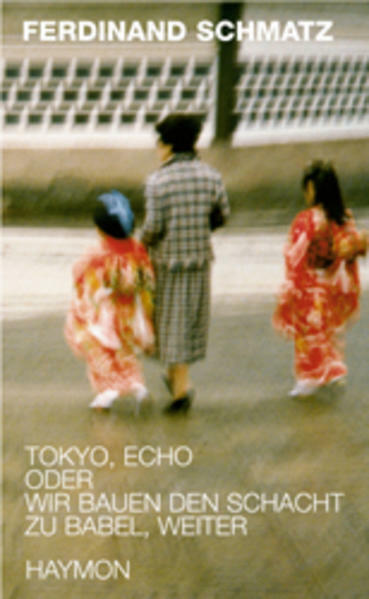Erich Klein in FALTER 15/2004 vom 07.04.2004 (S. 65)
Der neue Gedichtband von Ferdinand Schmatz tritt von Tokyo und Petersburg aus in Dialog mit den großen Dichtern der Moderne.
Als "vergurkung der silben zum verständnisträchtigen, die zur beeinträchtigung des verstehens führt" hat Reinhard Priessnitz einmal die Misere zeitgenössischer Lyrik nach ihrem Scheitern in der konkreten Poesie charakterisiert. An diesem Befund hat sich in den letzten zwanzig Jahren nicht viel geändert: ein abwechselnd engagiert raunzendes oder stammelndes Raunen war das Ergebnis dichterischer Produktion. Unbeirrbar und wider alle Moden hat der 1953 geborenen Wiener Lyriker Ferdinand Schmatz am Projekt festgehalten, dem Verstummen des Dichters eine zeitgemäße Form zu geben, die sich weder in "Vergurkung" noch "Verständnisträchtigkeit" ergeht. Zentrales Thema (nach einem Titel von Schmatz' Essaybänden): Sprache, Macht, Gewalt.
Die 59 Gedichte von Schmatz' neuem Gedichtband "tokyo, echo" ziehen den Leser unumwunden in ihren Sog.
"Das Auge zeichnet
immer nur sich selbst
ein Blick der zieht
was blieb im trieb,
und schiebt nach vor".
In Binnenreimen, lang vor- und weit rückläufiger rhythmischer Bewegung wird eine Fahrt durch Tokyo und Umgebung evoziert. Im fernöstlichen Reich der unlesbaren Zeichen beginnt der Sprechende/Reisende sich selbst an Bekanntem zu deuten: Reisfelder, Lichter der Großstadt, Papier, Lack, Pinsel, Mönch. Was wie das Klischee des europäischen Betrachters wirkt - auch die Kirschblüte fehlt nicht! - wird in überlappenden Wahrnehmungs- und Sprachebenen zu einem endlosen Wortzopf verflochten; was dabei entsteht ist "ein fahnen wehen, kein nur so sehen". Nicht die besinnliche Minimalmetaphysik des Haiku sondern Honda gibt das Tempo vor.
Gelassener und ruhiger verfährt der zweite Teil des Buches. Petersburg, Zentrum des russischen Imperiums, Schnittpunkt von Ost und West, von Bewusstem und Unbewusstem, Grenze von Land und Meer, wird in traditioneller wirkenden Gedichten durchmessen. Armut, Hinterhöfe, Schlangestehen, neureiche Kauflust, höchst touristische Orte, Kanäle, Paläste, "alle alleen stechen hier ins blaue", selbst Ikonen kommen vor. Nicht das Echo, sondern der "jetzt ton - nachklang" ist Leitidee. Im für Schmatz seit dem "großen babeln,n" typischen Tonfall geht es da los:
"was steigt, das neigt sich,
ein es fällt, im auge sinkt
sie, stadt geträumt, ringt ab
sich selbst das eis, sie winkt
uns her und schneit davon
was gibt sich weiss, ganz ton ..."
Das Eis des aufbrechenden Newa-Stroms, der die am Reißbrett entworfene klassizistische Stadt zerschneidet und ständig bedroht, hat nichts mehr mit einer Naturkatastrophe zu tun, wie sie Alexander Puschkin in seinem "Ehernen Reiter", dem literarischen Wahrzeichen der Stadt, beschrieb. Zwar umkreist auch Schmatz das Reiterstandbild von Peter dem Großen - sein Resümee jedoch lautet:
"kein reiter lieb
weit und gescheit".
Der dritte Teil "dichtung, echo" tritt in einen Dialog mit den Vorfahren: Robert Walser, Friederike Mayröcker, Wilhelm Busch, das Neue Testament. Kafkas Josefine mutiert zur singenden Geisha, Hölderlin wird mit ätherischer Substanz begegnet, H.C Artmanns Sprachbewegung zieht Schmatz mit der Figur des "Koträppchens" entgegen. Der Leser von Ferdinand Schmatz' Gedichten findet sich manchmal in wüster Ortlosigkeit wieder, in die er vom Autor gekonnt gelockt oder gewaltsam getrieben wurde: Dort aber trifft er auf etwas, das in der großen Mandelstamparaphrase folgendermaßen beschrieben wird:
"das donnert in der stille auf,
und steht dann drauf, verbrieft
dass, nimmer eingebrannt, das glück nie stück
wird, sondern lauf".
Dem kann, wer einmal zu lesen begonnen hat, kaum mehr Einhalt gebieten. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende.