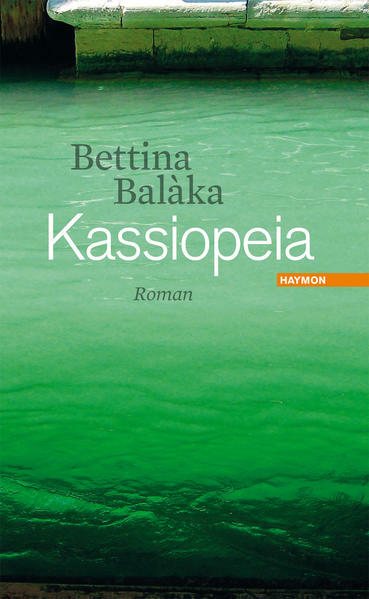Wege aus der Schlangengrube
Julia Kospach in FALTER 11/2012 vom 14.03.2012 (S. 12)
Venedig als Kulisse für einen Roman zu wählen ist eine heikle Sache. Die Fallen, die zwischen Canal Grande und Markusplatz aufgestellt sind, sind zahlreich und gefährlich. Sofort stehen die Klischees habt acht, kitschig-romantischen Szenerien und Seufzerbrücken-Sehnsüchte. Dass die Heldin in Bettina Balàkas neuem Roman "Kassiopeia" dann auch noch ausgerechnet einem Schriftsteller dorthin nachreist, macht es nicht gerade einfacher. Schriftsteller, die es zu Schreibklausuren an die inspirierenden Gestade Venedigs zieht, gab's und gibt es wie Sand am Meer.
Markus Bachgraben heißt der, dem Balàkas Protagonistin Judit Kalman, die wohlhabende, verwitwete und kapriziöse Erbin eines Salzburger Bauunternehmens, nachreist. Vor einigen Jahren hat er einen höchst erfolgreichen Liebesroman vorgelegt, der den Titel "Kassiopeia" trägt. Seither ist es wieder still um ihn geworden.
Er kämpft gegen das Verblassen seines Eintagsfliegenerfolgs. Seine Feinde heißen Geldmangel, Sozialversicherungsbeitrag und eingezogene Bankomatkarte. Da trifft es sich eigentlich gut, dass das Wort "Kassiopeia" auf Judit Kalmans Lieblingswörterliste auf Platz drei liegt. Sie misst diesem Umstand einige Bedeutung bei, was sie – quasi auf der Ebene der gewichtigen Zeichen – dazu berechtigt, sich unbemerkt zur Hüterin von Markus Bachgrabens Leben aufzuschwingen.
Tatsächlich verbindet sie mit ihm bisher nicht sehr viel mehr als ein einige Monate zurückliegender One-Night-Stand. Doch Judit Kalman hat Pläne, und in diesen kommt der beträchtlich jüngere Markus Bachgraben als Partner und Mitbewohner vor.
In "Kassiopeia" bürstet Bettina Balàka die Themen Liebesgeschichte und Frauenschicksal entschlossen gegen den Strich. Worauf das à la longue hinausläuft, kann man nicht verraten, ohne den Lesern dieses famosen Buchs den Spaß dran zu verderben. Also nur so viel: Es handelt sich um eine Art von wechselseitiger, heimlicher Manipulation, aus der dann gleichsam ohne Absicht doch so etwas wie Zuneigung entsteht.
Grundsätzlich sieht Balàkas Heldin alles Zwischenmenschliche als Schlangengrube: "Dass es so schnell zu Verletzungen kam, darin lag für Judit die Crux an menschlicher Gesellschaft. Durch das kleinste Missgeschick konnte die Zivilisation, die man mit sich alleine bestens instand hielt, in Gefahr kommen."
Balàkas Schlangengruben-Geschichte, in der zur Abwechslung einmal niemand elend zugrunde geht, ist originell und fantasievoll. Zusätzlich erzählt die Autorin auch noch in einem so eleganten Ton und unter Aufbietung wunderbaren Nebenpersonals, dass einen ihr Roman durchgängig in beste Laune versetzt. Vor allem zwei Dinge sind es, die dieses Buch auszeichnen: Die Gespräche sind in federleichter indirekter Rede dargestellt, deren Wirkung so ist, als würde ein pflichtbewusster Gerichtsschreiber, dem immer wieder sein Sinn für feine Ironie durchgeht, das Geschehen mitnotieren. Das allein ist ungeheuer komisch. So schwer kann das Tragische, das durchaus eine Rolle spielt, gar nicht werden, dass Balàka auch nur annähernd in Pathos verfiele.
Das Zweite sind die eigensinnigen Sprachbilder und Vergleiche, die auch altbekannte Klischees als etwas völlig Neues erscheinen lassen. Deswegen ist Venedig in diesem Buch auch keine Falle, in die man stolpern könnte. Im Gegenteil: Auch anderes, wie zum Beispiel die legendäre skandinavische Konsensbereitschaft, der eine von Balàkas Figuren nichts abgewinnen kann, verwandelt sich da zu einer "Konsenssülze", von der es weiter heißt: "Und da lägen dann alle wie die Schauschädel im gestockten Aspik, schwabbelten ein wenig und konnten sich sonst nicht mehr rühren."
Dass es außerdem noch einen Auftritt eines venezianischen Geists, eine Affäre zwischen einer Judit-Freundin und einem Gondoliere, grandiose Kurzporträts von Randfiguren, ein geschlossenes Anrücken von Judits Familie und die Entdeckung eines großen Familiengeheimnisses gibt, sind da nur noch zusätzliche Gustostückerln, die aus diesem Buch ein wirklich grandioses machen