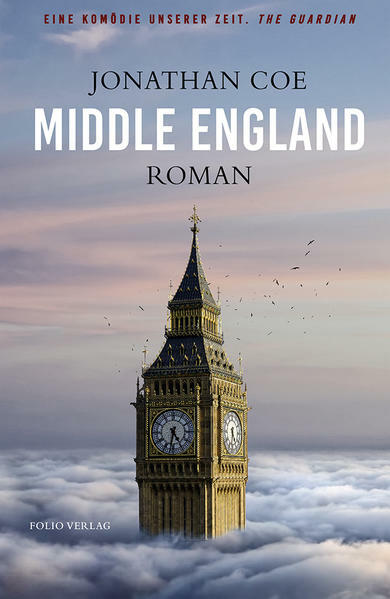Das einzig Gute am Brexit
Robert Rotifer in FALTER 11/2020 vom 11.03.2020 (S. 4)
In seinem Roman „Middle England“ spürt Jonathan Coe den jüngsten Entwicklungen seiner Heimat nach und erklärt im Gespräch, warum J.R.R. Tolkien für den Verbleib in der EU gewesen wäre
Die Reputation Großbritanniens als sympathischer Ort mag unter der Selbstsabotage der letzten Jahre stark gelitten haben, bloß der „britische Humor“ scheint das Fiasko unbeschadet überstanden zu haben und sich nach wie vor großer Beliebtheit zu erfreuen. Nur, was versteht man eigentlich darunter? Monty Python oder Phoebe „Fleabag“ Waller-Bridge? Den in New York den schnippischen Engländer gebenden Talk-Show-Komiker John Oliver oder den schottischen Brachialsatiriker John Niven?
Falls es sowas wie einen nationalen Mutterwitz überhaupt gibt, dann repräsentiert Jonathan Coe die von allen Obengenannten weit entfernte Nische des feinsinnigen Understatements. Seine großen Stärken – Sickerpointen, die sich über mehrere Kapitel hinweg ankündigen, parodistische Schreibstilwechsel, Schrullen des britischen Alltagsdiskurses – sind solche, die in Übersetzungen bald einmal verloren gehen.
Vielleicht lag es ja auch daran, dass sich Coes in Großbritannien beständig populäres Werk im deutschen Sprachraum bislang nicht so recht durchsetzen konnte. Die deutschen Titel seiner ersten beiden Erfolgsromane illustrieren das Problem: „What a Carve-up“ (1994) borgt sich seinen unübersetzbar wortspielerischen Titel von einer britischen Horrorkomödie aus dem Jahr 1961 und seziert die brutalen Konsequenzen der konservativen Privatisierungswut, bis kübelweise korruptes Kapitalistenblut spritzt (was der deutsche Titel „Allein mit Shirley“ kaum vermuten ließe).
Der autobiografisch getönte Entwicklungsroman „Rotters Club“ (2001) wiederum ist nach einem obskuren Album der Canterbury-Scene-Band Hatfield & The North benannt, passend zum popkulturellen Elitarismus der Hauptfiguren, die ihre Jugend am gutbürgerlichen Rand des Birmingham der 1970er-Jahre verbringen. Allerdings verdrängt schließlich der pöbelhafte Punk den mit Strebereifer verehrten Progressive Rock, und Thatchers Machtübernahme zerbricht die Don-Camillo/Peppone-artige Hassliebe zwischen Autoindustrie und Gewerkschaften. Im deutschsprachigen Raum wurde dieses tongenaue Sittenbild einer sich wandelnden britischen Klassengesellschaft einigermaßen irreführend als „Erste Riten“ auf einen mäßig interessierten Markt geworfen.
Dank „Middle England“, das bereits mit dem Europäischen Buchpreis und als Roman des Jahres bei den britischen Costa Awards ausgezeichnet wurde, könnte sich das bald ändern. Schließlich sehnt sich eine von Ian McEwans Novelle „The Cockroach – die Kakerlake“ enttäuschte anglophile Klientel schon lange nach einer brauchbaren literarischen Ergründung des Nervenzusammenbruchs ihrer britischen Seelenheimat (im Original erschien Coes Buch übrigens ein Jahr vor dem McEwans).
Löblicherweise hat der kleine, aber weise Folio Verlag, der sich Coe mit seinem letzten Roman „Nummer 11“ geangelt hatte, den Romantitel diesmal unübersetzt belassen. Das tröstet auch darüber hinweg, dass auf dem Umschlag der St Stephen’s Tower von Westminster zu sehen ist. Leider unpassend, spielt diese Geschichte doch aus gutem Grund weniger in London als in der medial vernachlässigten Brexit-Hochburg Mittelengland, sprich den Midlands.
„Middle England“ steht im britischen Politjargon aber auch englandweit für die weder arme noch wohlhabende, weder un- noch hochgebildete Mittelschicht. Genau jenes Segment also, dessen Stimmen – entgegen dem etablierten Narrativ von der frustrierten Working Class – beim Brexit-Referendum 2016 den Ausschlag gaben.
„Ich wollte nicht auf diese Leute herabblicken“, sagt Jonathan Coe, „die hauptstädtische Arroganz gegenüber den Provinzen hat über die letzten Jahre viel Schaden angerichtet. Ich selbst lebe nun schon seit 33 Jahren in London und bin ein Teil der liberalen Elite. Aber ich verbrachte die ersten zwei Jahrzehnte meines Lebens in den ländlichen Vorstädten von Birmingham.“
Der Falter trifft den 58-jährigen Schriftsteller im Gilbert Scott, jenem Lokal in der Londoner St. Pancras Station, das im Roman Schauplatz eines Gesprächs zwischen der in Birmingham aufgewachsenen Sophie und ihrem schwulen, anglo-singhalesischen Freund Sohan ist. In dieser unaufgeregt geschilderten Schlüsselszene entpuppt sich das Klischee des moderat besonnenen Englands als Selbstbetrug der liberalen weißen Mittelklasse.
„Das Gespräch mit Sohan beruht auf einer Unterhaltung mit einer dunkelhäutigen Freundin kurz nach der Brexit-Abstimmung, als in den Zeitungen von einem sprunghaften Anstieg fremdenfeindlicher Hassverbrechen zu lesen war“, erklärt Coe. „Als ich ihr sagte, wie sehr mich das beunruhige, meinte sie: ,Toll, dass du jetzt bemerkst, womit ich seit über vierzig Jahren lebe.‘ Sie habe sich in einem britischen Pub oder auf einer nächtlichen britischen Straße nie völlig sicher gefühlt. Ich war schockiert.“ Wenn es am Brexit etwas Gutes gäbe, dann sei es der Umstand, „dass er uns zu schmerzhaften Gesprächen zwingt, die wir wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten hätten führen sollen. Ich habe in den letzten drei Jahren mehr über den Zustand des Landes nachgedacht als in meinem ganzen Leben davor.“
Eigentlich hatte Coe nach der ersten Fortsetzung des „Rotters Club“ in „Klassentreffen“ (original „The Closed Circle“, 2004) einen dritten Teil jener Saga schreiben wollen, aber der britische Verlag wünschte sich stattdessen ein politisches Buch zum Brexit. Die logische Schlussfolgerung war eine Kombination beider Ideen. In „Middle England“ begegnen wir Benjamin Trotter im Jahr 2010 als unveröffentlichtem Autor wieder, der sich in die ländliche Einschicht zurückgezogen hat. Seine Schulkollegen aus dem Elitegymnasium schreiben mittlerweile für den Guardian, arbeiten für einen rechten Thinktank oder als Kinderclown in einem Garden Centre in Worcestershire.
„Früher hätte man dort nur Pflanzen für den Garten gekauft“, erklärt Coe. „Aber inzwischen haben sich diese Zentren förmlich zu Dörfern entwickelt, die die ausgestorbenen und verwahrlosten Dörfer ersetzen, in denen das einzige Pub aufgelassen wurde und im Supermarkt polnisches und rumänisches Personal arbeitet. Das Garden Centre ist aber auch ein Ort, wo Menschen, die den Krieg nicht wirklich erlebt haben, Churchill-Biografien kaufen.“ Die zunehmend zur nationalen Obsession geratene Verklärung der eigenen Kriegsvergangenheit aber sei eine gar nicht so harmlose britische Marotte: „Neulich war ich in einem Café in Nottingham, das ganz nach dem Thema des Zweiten Weltkriegs eingerichtet ist. Die Speisekarte war in Form eines Hefts von Essensmarken gedruckt. Wir haben ein Problem in diesem Land.“
Coe spricht bewundernd von Julian Barnes’ satirischem Roman „England, England“ (1998), in dem die Isle of Wight in einen englischen Themenpark verwandelt wird, versteht den eigenen Roman aber nicht unbedingt als Satire: „Ich tue mir dieser Tage überhaupt recht schwer damit, den jüngsten Entwicklungen Amüsantes abzugewinnen.“
„Middle England“, dessen Handlung sich über mehrere Jahre erstreckt, beschreibt das allmähliche Abdriften der britischen Gesellschaft in Richtung Brexit. Der offen engagierte Remainer Coe bemüht sich dabei merklich, Befürworter dieser Entwicklung wie etwa Benjamins pensionierten Vater Colin nicht zu karikieren, sondern als komplex motivierte Menschen zu zeichnen. Auf der anderen Seite neigt er bisweilen zur Idealisierung seiner weniger privilegierten Figuren.
Dass gelegentlich eine wohlwollend versöhnliche Didaktik durchblitzt, ist vielleicht das Einzige, was man „Middle England“ vorwerfen könnte. Zugleich stellt das Verständnis für die Gegenseite im tief gespaltenen Großbritannien eine geradezu radikale Geste dar.
Um seinen Roman einem nicht-englischen Publikum zu erklären, zieht Jonathan Coe, der mittlerweile einen weißen Vollbart trägt, einen überraschenden Vergleich:
„,Middle England‘ ist das Auenland aus ,Herr der Ringe‘, und die Mittelengländer sind die Hobbits. Tolkien stammt so wie ich aus der südwestlichen Vorstadt von Birmingham und hat als Bub viele Wanderungen durch die Wälder unternommen. Ich sehe ,Herr der Ringe‘ nicht mehr als Fantasy-Roman, sondern als ein Buch über die provinziellen Midlands, aber auch über das Verhältnis der Briten zu Europa. Die Gemeinschaft des Ringes ist so wie die EU eine Zweckallianz verschiedener Stämme und Spezies. Die Hobbits zögern am längsten mit ihrem Beitritt, werden dann aber zu den wertvollsten Verbündeten. Tolkien wäre ein entschlossener Remainer gewesen und ,Herr der Ringe‘ ein ganz anderer Roman geworden, hätten die Hobbits sich nach zwei Dritteln gesagt: ‚Gut, wir gehen doch nicht nach Mordor, wir sind draußen.‘“