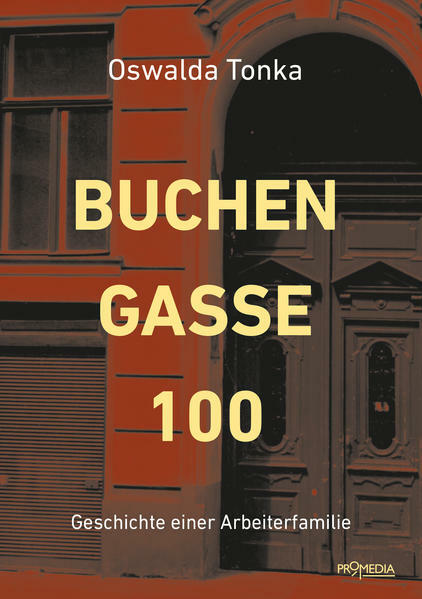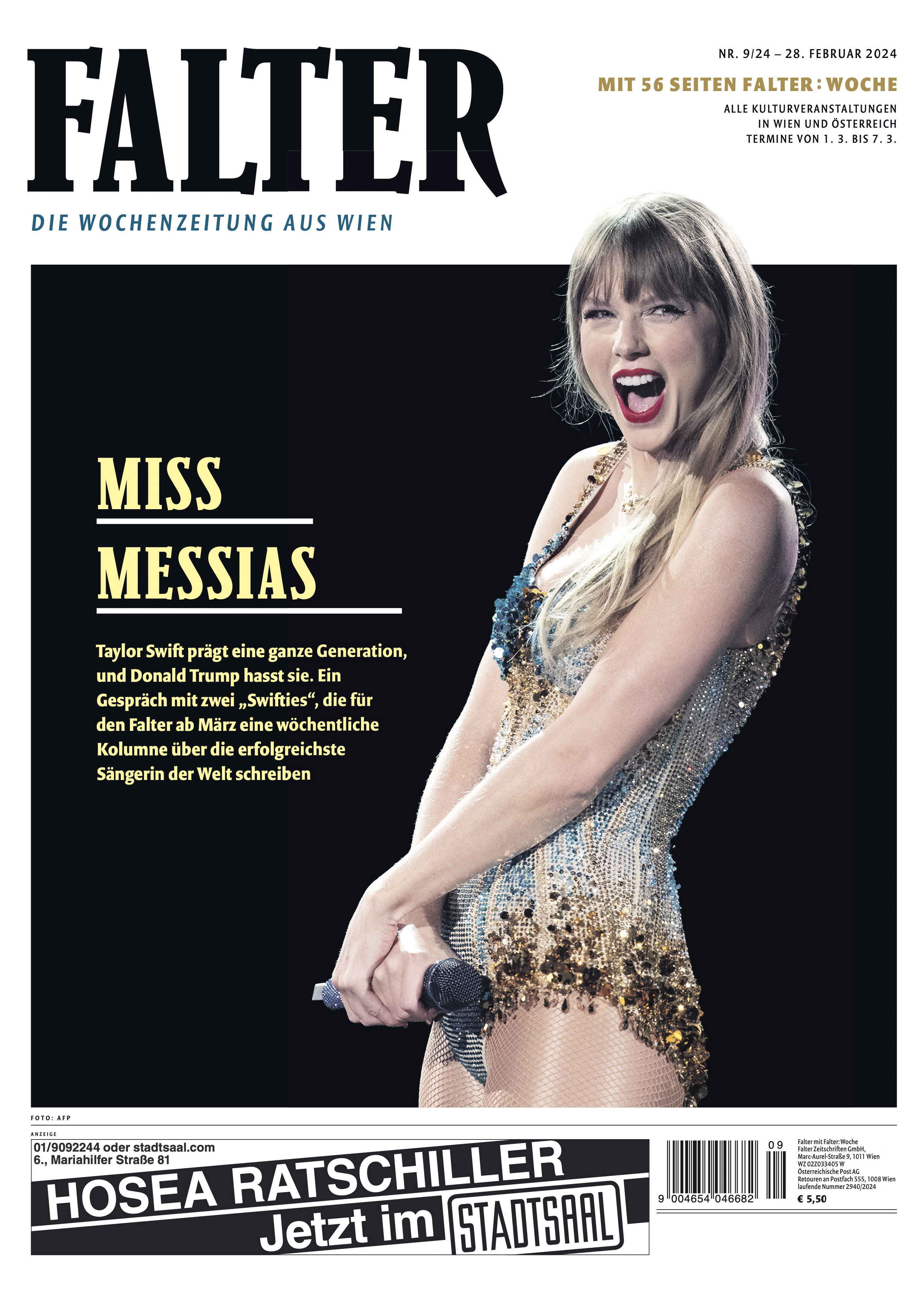
TONKAS FAVORITEN
Benedikt Narodoslawsky in FALTER 9/2024 vom 28.02.2024 (S. 42)
Im Hochparterre in der Buchengasse 100 streicht Gitta Tonka zärtlich übers dunkle Holz der Wohnungstür. Hier ist ihr Favoriten noch genauso wie damals. Die Fliesen, die vergitterten Fenster, die Treppen, die Bassena, die Madonnenstatue im Stiegenhaus, die Tür zum Gangklo, das sich die Hausbewohner teilen mussten.
"Auf den Haken ist Zeitungspapier zum Abwischen gehängt", erzählt Tonka. Selbst die Hausordnung ist noch am Gang angeschlagen, vergilbt, zerrissen, aber großteils noch leserlich. Punkt 9: "Das Verkleinern des Holzes und der Kohlen darf nur im Keller oder in den Höfen auf den vorhandenen Hackstöcken stattfinden und ist niemals im Inneren der Wohnung gestattet."
Hier in der Buchengasse arbeitete ihr Großvater als Metalldrucker in der Kellerwerkstatt, an der Bassena holten ihre Großtanten das Wasser, an die Holzeingangstür klopfte ihre Mutter, als sie von den Partisanenkämpfen im Zweiten Weltkrieg aus Jugoslawien heimkehrte. Seit ihrer Geburt lebt Tonka, Jahrgang 1952, in Favoriten.
Seitdem ihr Urgroßvater, Jakob Sokopp, hier Arbeit fand, ist der Bezirk über vier Generationen hinweg das Zentrum ihrer Familiengeschichte. Tonka hat sie in zwei Büchern niedergeschrieben. 2015 gab sie unter dem Titel "Buchengasse 100" posthum die Memoiren ihrer Mutter heraus, der kommunistischen Widerstandskämpferin Oswalda Tonka. 2022 veröffentlichte die pensionierte Schuldirektorin das Buch "Favoriten", in dem sie die Geschichte ihrer Familie mit jener des Bezirks verwob.
Die Geschichte des zehnten Bezirks begann vor 150 Jahren. 1874 gemeindete Wien die Felder ein, die südlich der so genannten Linie lagen. So bezeichneten die Wiener den Linienwall, den Kaiser Leopold I. nach der Türkenbelagerung als Befestigungsanlage bauen ließ - und der sich entlang des heutigen Gürtels zog. Die südliche Grenze - die Favoritenlinie -war nach der kaiserlichen Sommerresidenz Favorita benannt, der heutigen Theresianischen Akademie an der Favoritenstraße im vierten Bezirk.
Der Linienwall hegte die Stadt ein, im Süden aber reichten die Bezirke Wieden und Margareten über ihn hinaus. 1874 formte Wien aus diesen Gebieten jenseits der Grenze den neuen, zehnten Wiener Bezirk. Favoriten feiert das 150-Jahr-Jubiläum mit Festakten, am Wochenende präsentierte der Verein der geprüften Wiener Fremdenführer ein eigenes Favoriten-Magazin im Festsaal der Bezirksvorstehung. Zu erzählen gibt es viel. Denn Favoriten ist mehr als ein Bezirk. Es ist eine Chiffre: für die Wiege der Arbeiterbewegung; für das wachsende Wien; für das Ausländerthema. Favoriten ist die Spielwiese der Wiener Austria, Drehscheibe des österreichischen Bahnverkehrs, das Zuhause von Edmund "Mundl" Sackbauer, dem Prototypen des Proletariers. Kaum ein anderer Bezirk in Österreich bietet mehr Projektionsfläche.
Selbst alteingesessene Favoritner wie Gitta Tonka werden mit dem Entdecken nicht fertig. Im Norden liegt das dicht verbaute Innerfavoriten, im Süden die Äcker von Rothneusiedl und Oberlaa. Je nach Standpunkt sieht Favoriten aus wie ein Großstadtdschungel oder die niederösterreichische Pampa. "Das ist die Komenskyschule!", ruft Tonka in der Leibnizgasse nahe der U-Bahn-Station Reumannplatz erfreut aus, so, als hätte sie einen Schatz gefunden. Die ehemalige Schule des tschechischen Schulvereins erlebte im Roten Wien ihre Blüte. "Das ist berührend, das die noch steht!", sagt sie über das historische Gebäude, "ich bin ja mit diesen böhmischen Einwohnern aufgewachsen."
Wer sich vor 200 Jahren vom Süden der Kaiserstadt näherte, sah vor allem eines: Wiesen und Felder. Die Industrialisierung änderte das Landschaftsbild. Im 19. Jahrhundert zogen Unternehmer auf Äckern und Feldern ihre Fabriken hoch: Es gab Platz. Der Grund war billig. Und neue Transportwege taten sich auf. In der Gegend des heutigen Wiener Hauptbahnhofes eröffneten in den 1840er-Jahren zwei Kopfbahnhöfe: der Wien-Gloggnitzer-Bahnhof und der benachbarte Raaber Bahnhof. Der erste eröffnete die Südbahn, die bald bis Triest führen sollte. Der zweite die Ostbahn, die die Kaiserstadt mit der ungarischen Stadt Győr (zu deutsch: Raab) verband.
Bald war von den grünen Wiesen und gelben Kornfeldern nichts mehr zu sehen. "In ödester Einheitlichkeit reihen sich die immer grauen oder braunen, immer düsteren Häuser zu Straßen, zu Längs-und Querstraßen, die von Simmering bis Inzersdorf reichen, oder bilden da und dort Plätze. Diese sind gleich trostlos, wie die Häuser und die Gassen", schrieb der Reporter Max Winter in seiner Artikelserie "Rund um Favoriten" im Dezember 1901 für die Arbeiter-Zeitung.
"Der Ziegelrohbau irgendeiner Fabrik mit seiner wahnsinnig gleichmäßigen Fensterflucht -drei Stockwerke übereinander - ist die einzige Abwechslung in dem Bild. Über dem ganzen lagert Rauch und Staub, und durch alle Gassen rast der Lärm der Industrie. Lichtblicke nirgends und nirgends auch Ruheplätzchen. Alles öde, alles nüchtern, grau in grau alles -das ist Favoriten!"
Gitta Tonka spaziert über die noch immer graue Quellenstraße, vorbei an Kebabläden, Herrenfriseuren und Handygeschäften, die heute das Bild von Innerfavoriten prägen. In ihrer Kindheit sei das anders gewesen. "Ich bin mit Fabriken aufgewachsen", sagt sie und mimt das Geräusch der Fabriksirenen nach, die zum Dienstschluss ertönte: "Tüüt. Das war das Signal, dann sind die Leute herausgekommen." Sie erzählt vom süßen Duft, den die Arbeiter aus der Schokoladenfabrik umwehte. Und vom Gestank der vorbeiziehenden Arbeiter aus der Fischfabrik. In Tonkas Stimme schwingt der Grundton der Nostalgie.
Am Quellenplatz hupen Autos, klingelt die Straßenbahn und ticken die Ampeln, aber die Fabriksirenen sind verstummt. Die ehemalige Maschinenfabrik Gläser an der Quellenstraße beherbergt nun die Favoritner Gebietsbetreuung. Dort, wo die Heller-Fabrik in der Gußriegelstraße bis in die 1970er-Jahre Zuckerln herstellte, steht heute ein Wohn-und Pflegezentrum. Die Ankerbrot-Fabrik im Osten des Bezirks wurde zu einem Kulturzentrum mit schicken, teuren Wohnungen.
Laut einer Statistik, die der Bezirk 2022 veröffentlichte, zählen heute nur noch sechs Prozent der Favoritner Arbeitsplätze zur Industrie. Drei Viertel der Menschen, die im Bezirk ihr Geld verdienen, arbeiten als Dienstleister, die meisten in den Sektoren Finanzen, Beratung und Handel.
Am Selbstverständnis als Arbeiterbezirk hat das wenig geändert. Allen politischen Widrigkeiten zum Trotz ist der zehnte Hieb eine Hochburg der SPÖ geblieben. Wenn Österreich ein rotes Herz hat, dann begann es hier zu schlagen. Die Sozialdemokraten haben ihre Geschichte in Favoriten eingeschrieben. Hier trifft die Pernerstorfergasse auf den Viktor-Adler-Markt, der gleich hinter dem Reumannplatz liegt. Jakob Reumann war der erste sozialdemokratische Bürgermeister der Stadt, Engelbert Pernerstorfer der erste sozialdemokratische Vizepräsident des Reichsrates in der Monarchie. Victor Adler gilt als der Vater der österreichischen Sozialdemokratie.
Seinen ersten politischen Erfolg feierte der Armenarzt und Journalist hier in Favoriten. Als verdeckter Reporter ließ sich Adler ins Ziegelwerk am Wienerberg einschleusen. In seiner Zeitung Gleichheit schrieb er 1888 über "die ärmsten Sklaven, welche die Sonne bescheint", den "Hunger und das Elend, zu dem sie verdammt sind", und die Behausung der Ziegelarbeiter. "In einem dieser Schlafsäle hat eine Frau in Gegenwart der 50 halbnackten, schmutzigen Männer, in diesem stinkenden Dunst entbunden!" Seine Reportage rüttelte die Öffentlichkeit und Behörden auf und verbesserte letztlich die Bedingungen der Arbeiter.
Gitta Tonka passiert die Hasengasse - wo der echte Wiener Edmund "Mundl" Sackbauer wohnte -, und schreitet nördlich die Laxenburger Straße Richtung Hauptbahnhof. Sie bleibt vor einem prächtigen Jugendstilhaus stehen, dem Arbeiterheim. "Hier sind wir zu Hause. Wir haben ein Heim!", hatte Victor Adler in seiner Eröffnungsrede 1902 gesagt.
Hier hielten die Sozialdemokraten Parteitage ab, organisierten Streiks, planten Maiaufmärsche. Das Gebäude wird gerade renoviert, 2026 will die Wiener SPÖ von der Löwelstraße in der Innenstadt nach Favoriten übersiedeln. Tonka freut die geplante Heimkehr. "Das Arbeiterheim gehört zu Favoriten", sagt sie. "Jeder, der jemals ein Favoritner war, kennt es."
Tonka gehört keiner Partei an, aber ihre Familiengeschichte ist eng mit jener der Arbeiterbewegung verknüpft. Im Buch "Buchengasse 100 -Geschichte einer Arbeiterfamilie" erzählt sie anhand der Memoiren ihrer Mutter vom Leben ihres Urgroßvaters Jakob Sokopp. Wie er bei seiner streng gläubigen Großmutter auf einem Bauernhof in Mähren aufwuchs. Wie er seiner Mutter nach Wien folgte, um Arbeit zu suchen. Wie sich die Familie dort das Bett mit Fremden (den Bettgehern) teilen musste, um sich die Wohnung leisten zu können.
Wie Sokopp den Glauben an die Kirche verlor und ihn in der Arbeiterschaft wiederfand. Wie seine Mutter an Tuberkulose erkrankte, die unter den Wiener Hacklern so häufig war, dass man sie sowohl "Proletarierkrankheit" als auch "Wiener Krankheit" nannte. "In der Sterbeurkunde wurde als Todesursache Lungenschwindsucht angegeben. In Wahrheit, meinte Jakob, sei sie am Kapitalismus gestorben", schreibt Tonka. 1874 marschierte Sokopp zu Fuß nach Baden, um von dort mit anderen nach Neudörfel weiterzufahren. Dort gründete er mit anderen Genossen am ersten Parteitag die Sozialdemokratie und baute Jahre später die Gewerkschaft der Metalldrucker mit auf.
Jakob Reumann, Wiens erster sozialdemokratischer Bürgermeister, war Sokopps Haberer. Im Roten Wien Anfang der 1920er-Jahre blühte Favoriten auf. Und mit ihm die Arbeiterschaft. Die Sozialdemokraten reformierten die soziale Fürsorge, das Schulwesen, den Wohnbau. Am Reumannplatz entstand mit dem Amalienbad eines der größten Hallenbäder Europas, ein Prestigebau des Proletariats im Art-déco-Stil. Die Roten würfelten Gemeindebauten in die Stadt, mit grünen Höfen, Kindergärten, Leihbibliotheken.
Auch Tonkas Mutter übersiedelte mit ihrer Familie in einen Gemeindebau in der Favoritner Troststraße. Die Miete war billig, die Wohnung hatte fließendes Wasser und ein Klo, in der Küche standen ein Gasherd und ein Koksofen. Den Hof mit dem Spielplatz bezeichnete die Mutter als "Paradies für uns Kinder". Als die Austrofaschisten die Sozialdemokratie vor 90 Jahren politisch ausschalteten und Österreich im Bürgerkrieg versank, lag die Kommandozentrale der roten Schutzbündler im George-Washington-Hof, einem riesigen Gemeindebau westlich der Triester Straße.
Wenige Schritte davon entfernt steht das Wahrzeichen der Favoritner, die Spinnerin am Kreuz, eine gotische Bildsäule, die der Baumeister des Stephansdoms, Hans Puchsbaum, Mitte des 15. Jahrhunderts errichten ließ. Auf historischen Bildern sieht man sie majestätisch vor weiten Feldern in Szene gesetzt, erst am Horizont taucht Wien auf. Heute hat die Stadt die Spinnerin verschluckt. Auf der sechsspurigen Strecke, gesäumt von Tankstellen, Autohäusern, gesichtslosen Häuserschluchten, Puffs und dem Wiener Arbeiterstrich, wirkt sie wie ein trauriges Mahnmal eines wuchernden Molochs.
Gemessen an der Bevölkerung überflügelt Favoriten Linz, Österreichs drittgrößte Stadt. Und der zehnte Hieb wächst rasch weiter. Lebten vor 20 Jahren noch 156.349 Menschen im Bezirk, waren es im Vorjahr schon 218.415 -also um 40 Prozent mehr. So viele wanderten zu, wie heute in St. Pölten wohnen. Kräne gehören deshalb zum Favoritner Stadtbild. Sie zogen das Quartier Belvedere hinterm Gürtel hoch, in das René Benko Hochhäuser auf Stelzen hinwuchtete. Die Erste Bank ließ sich einen Glaspalast als neue Zentrale bauen.
Auf den ehemaligen Gleisen der Bahnhöfe schuf Wien das Sonnwendviertel, dort spielen Kinder von Akademikern und Hacklern gemeinsam im Motorikpark. Auf Rasengleisen umkurvt der D-Wagen den weitläufigen Helmut-Zilk-Park, benannt nach dem ehemaligen Wiener SPÖ-Bürgermeister. Selbst im Kreta-Viertel -ein Grätzel an der östlichen Grenze zu Simmering, das lange als der gefährlichste Bezirk galt - verspricht die Stadt auf den ehemaligen Siemensgründen "ein neues, vielfältiges Stadtquartier mit hohem Grünanteil". Einen Steinwurf vom Kreta-Viertel entfernt residiert seit 2019 die Central European University.
Die Favoritner sind im Schnitt deutlich jünger, ärmer und schlechter gebildet als im Wiener Durchschnitt, aber der Akademikeranteil steigt, und der Bobo-Anteil ebenso. Am stärksten aber wuchs der Anteil der Zuwanderer. In den vergangenen zwei Jahrzehnten blieb die Zahl der gebürtigen Österreicher in Favoriten erstaunlich stabil (116.000). Und doch werden sie im Verhältnis weniger. 2003 waren drei von vier Favoritnern gebürtige Österreicher. 2023 war es nur noch jeder zweite.
Den Viktor-Adler-Markt, wo die Kopftuchdichte deutlich höher ist als in den meisten Teilen Wiens, nützt die FPÖ in Wahlkämpfen regelmäßig zur Stimmungsmache gegen Ausländer. 2018 drehte Viktor Orbáns damaliger ungarischer Kanzleramtsminister János Lázár am benachbarten Reumannplatz ein Wahlkampfvideo, unterlegte es mit schicksalhaftem Gedudel und warnte, Budapest könne wie Wien werden.
Im Sommer vor vier Jahren eskalierte die Situation dann tatsächlich. Türkische Nationalisten griffen nach Kurdendemos Linke an. Die Ausschreitungen zogen sich über mehrere Nächte, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nannte die Vorfälle "inakzeptabel", selbst die damalige grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein forderte ein "offensives Einschreiten der Polizei" und warnte vor den Faschisten.
Tonka schwärmt von ihrem Bezirk, aber sie kritisiert die geringe Durchmischung, erzählt von Häuserblocks und Geschäftsvierteln, die sich in Ghettos verwandelt hätten. Als Schuldirektorin hat sie selbst erlebt, wie ihr Väter von Schülern nicht mehr die Hand geben wollten. Schülerinnen, die nicht mehr am Schwimmunterricht teilnehmen durften. Favoritner Kinder, die die Bundeshymne nicht mitsangen, weil sie sich als Türken fühlten.
Sie wünscht sich eine Politik wie im Roten Wien, als die Stadtpolitik Gemeindebauten wie den Karl-Marx-Hof den reichen Döblingern vor die Villen klotzte. "Ausländische Familien in allen Bezirken ansiedeln, bei Bedarf mit Mietzinsbeihilfe!", fordert sie von der Politik.
Auch Tonka zog um, sie wohnt heute im grünen Teil von Favoriten. Ihre Familiengeschichte erzählt eine des gesellschaftlichen Aufstiegs der Arbeiterklasse durch Bildung. Schon die Großtanten hatten sie ermahnt, in der Schule aufzupassen, damit sie nicht wie sie selbst in der Fabrik schuften müsse. Statt in der Substandardwohnung in der Buchengasse lebt sie heute in einem Häuschen in der Kleingartensiedlung nahe dem Wienerberg.
Dort, wo früher die Ziegelarbeiter malochten, genießen die Favoritner heute Ruhe in der Natur und baden im Sommer in Ziegelteichen. Aus dem Höllenschlund der Industrie hat die Stadt eines der schönsten Naherholungsgebiete Wiens gemacht.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: