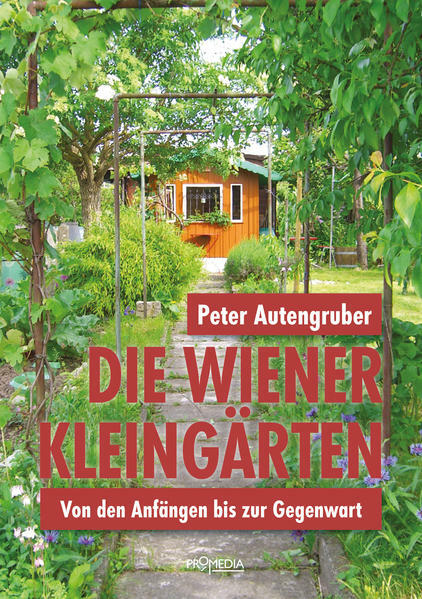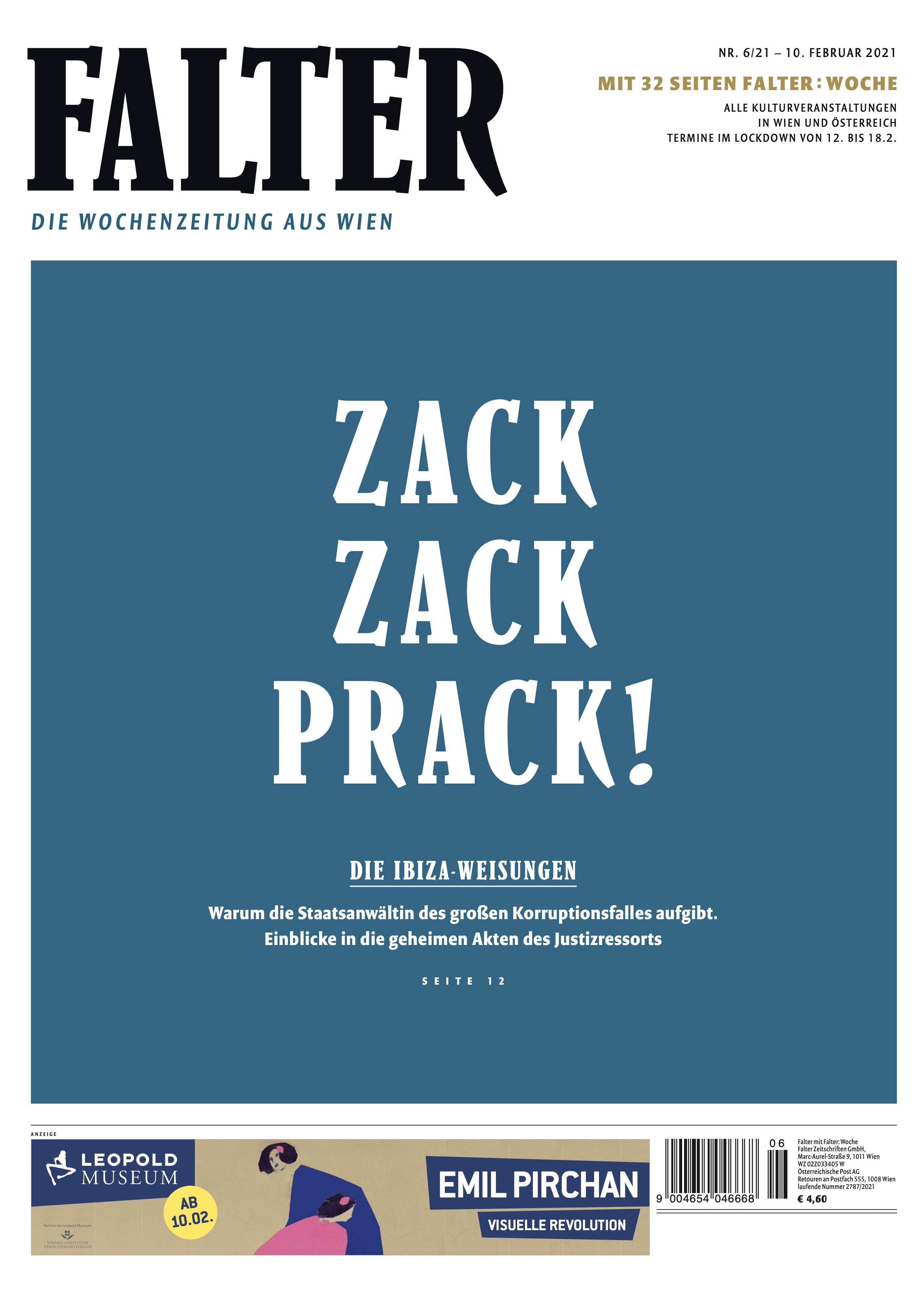
Klein, aber mein
Birgit Wittstock in FALTER 6/2021 vom 10.02.2021 (S. 40)
An schönen Tagen könne man bis zum Schneeberg sehen, sagt Sylvia Wohatschek und deutet mit der Hand in die dichte Nebelsuppe. Statt eines Berggipfels ist heute bloß die Spitze der wuchtigen Betonkirche zum heiligen Franz von Sales zu sehen, die einige hundert Meter weiter aus der Per-Albin-Hansson-Siedlung ragt. Selbst die Heuberggstätten, das mit wenigen Bäumen bestandene riesige Grün, das sich jenseits von Wohatscheks Gartenzaun breitmacht, wird nach nur wenigen Metern vom Grau verschluckt.
Obwohl das Wetter die Aussicht verwehrt, lässt sich erahnen, wie gut es sich hier wohnt.
Sylvia Wohatscheks Paradies ist keine unerschwingliche Villa im Speckgürtel. Ihr kleines Haus mit den 350 Quadratmetern Garten und dem freien Blick über die Ausläufer der Stadt liegt im Arbeiterbezirk Favoriten – exakt sieben U-Bahn-Stationen von der Innenstadt entfernt.
Das Grundstück hat sie von der Stadt Wien gepachtet, 3,40 Euro kostet der Quadratmeter Kleingarten aktuell im Jahr, also knappe 1200 Euro. Unbefristet.
So wie Wohatschek wohnt jeder zweite ihrer Nachbarn auf den umliegenden 66 Parzellen des Kleingartenvereins Ettenreich zur Pacht. Wer es sich leisten konnte und wollte, hat sich sogar den Traum vom Grundbesitz in der Großstadt erfüllt.
Und das so billig wie in keiner anderen europäischen Metropole: 29 Jahre lang hat die Stadt Wien öffentlichen Grund an ihre Pächter in den Kleingärten verkauft – um bis zu 45 Prozent unter dem Marktwert, wie der Rechnungshof 2016 kritisierte.
Genau das ist nun Geschichte. Vorvergangene Woche verkündete Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Katrin Gaál (SPÖ), die Stadt werde künftig keine Kleingartenparzellen mehr verkaufen. Sie repariert damit einen jahrzehntealten Irrtum, der die Spekulationen mit den Kleingärten wie die Thujen sprießen ließ.
Immer wieder landeten abbruchreife Kleingärten um mehrere hunderttausende Euro auf Marktplätzen wie Willhaben.at. Die Inserenten waren ehemalige Pächter, die die Grundstücke um einige zehntausende Euro von der Stadt gekauft hatten.
Andere ließen sich ihre günstige Kaufoption um den vielfachen Preis von Immobilienunternehmen ablösen, die das große Geschäft mit Grünparzellen machten. Das konnte auch das zehn Jahre währende Vorkaufsrecht der Stadt nicht verhindern, das die Gemeinde als Spekulationsfrist festgelegt hatte. Verkaufswillige Pächter saßen die Zeit einfach aus.
Das Griss um die Wiener Kleingärten tobt seit Jahrzehnten: etwa 25.000 bis 30.000 Parzellen gibt es in Wien, davon gehören aktuell noch 13.805 der Stadt; 5363 Kleingärten hat sie bislang verkauft. Die übrigen gehören dem Stift Klosterneuburg, der Erzdiözese, Privatverbänden und dem Bund, dessen Flächen die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) verwaltet.
Die Kleingärten der Stadt Wien (wie jene in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark) verwaltet der Zentralverband der Kleingärtner und Siedler Österreichs, der sie gepachtet hat und sie über Vereine an die jeweiligen Unterpächter weitergibt.
Würde man sämtliche Wiener Kleingartensiedlungen des Zentralverbandes zusammenlegen, ergäbe sich ein eigener Stadtteil, so groß wie die Bezirke Margareten und Rudolfsheim-Fünfhaus zusammen, mit mehr als 50.000 Einwohnern, so viel wie in ganz Währing.
Die Kleingarten-Parzellen waren seit Beginn der Besiedlungsbewegung 1904 ein Ort der Begehrlichkeiten. Einst als Freak-Kolonie skeptisch beäugt, waren die sogenannten „Grabgärten“ nach dem Ersten Weltkrieg überlebensnotwendige Nahversorger.
Später wurde der Schrebergarten für viele zum Inbegriff des Spießertums, für andere aber zum Sehnsuchtsort, an den sie an den Wochenenden und im Sommer aus ihren Wohnungen fliehen konnten. Vom leistbaren kleinen Fleckchen Grün in der Stadt träumen viele Wiener, selten aber werden Gärten zur Pacht frei, meist über Generationen vererbt. Die Wartelisten sind so lang, dass der Zentralverband keine neuen Anmeldungen mehr annimmt. Entsprechend groß ist der Neid auf die wenigen, die einen Kleingarten ergattert haben.
„Eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält“, damit hätte der deutsche Lyriker Christian Friedrich Hebbel einst nicht Österreich, sondern genauso gut den Mikrokosmos Kleingarten gemeint haben können.
Dort lassen sich fast alle Wiener Dramen der vergangenen Jahrzehnte nachverfolgen: Der Kleingarten erzählt eine Geschichte über Freunderlwirtschaft, verpatzte Stadtplanung, den Machtverlust der SPÖ und den Aufstieg der FPÖ, Spekulation und den Konflikt zwischen Gesinnungen und Generationen.
Einer, der die Geschichte fast von Anfang an kennt, ist Ferdinand – oder Ferry, wie er sich vorstellt – Kovarik. Der ehemalige rote Bezirksrat und einstige Obmann des Kleingartenvereins Waidäcker in Ottakring ist wohl das, was man in Wien unter einer Bezirkslegende versteht.
1941 dort geboren, in einer Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung mit seiner Mutter, seiner kleineren Schwester, die mit vier Jahren an Typhus starb, seinen Großeltern und seinem Onkel aufgewachsen.
Kovarik verbrachte sein Leben in diesem Bezirk, die meiste Zeit davon im Kleingartenverein Waidäcker. Dort habe sein Onkel 1918 eine Parzelle angeboten bekommen, erzählt Kovarik, 79, dunkelblaues Paisley-Hemd, ein hochgewachsener Mann, die großen, kräftigen Hände eines Arbeiters und die tiefe Stimme eines Seemannes.
Anfangs waren die rund 300 Quadratmeter nichts weiter als nackte Erde, der sein Onkel und seine Mutter Erdäpfel, diverse Küchengemüse, Erdbeeren, Ribiseln, Stachelbeeren und Marillen abzuringen versuchten. Er spielte währenddessen mit Dutzenden anderen Arbeiterkindern, deren Eltern mit der Bestellung ihrer Grabgärten beschäftigt waren, im Schutzhausgarten oder zog durch den nahen Wiener Wald. Erst später zimmerte der Onkel eine kleine, hölzerne Gartenhütte, die er nach und nach auf die damals erlaubten 35 Quadratmeter ausbaute. Küche, Zimmer, Kabinett.
An den Sommerwochenenden habe Ferry Kovarik nachts auf einer Matratze im Dachgiebel gelegen und zu den Sternen geschaut, während in den Gärten rundum die Grillen zirpten.
Einzig der Marillenbaum im Garten, Sorte „Ungarische Beste“, ist aus Kovariks Kindheit geblieben. Seit gut 60 Jahren trägt der Baum Früchte, so süß, dass ihn selbst Kovariks Freund, der Ottakringer Marmeladenhersteller Hans Staud, um sie beneidet. Zumindest behauptet das Ferry Kovarik.
Anstelle der hölzernen Gartenlaube von einst steht heute der klassische Wiener Kleingartenbau auf Kovariks Parzelle: ein solides, kleines Haus, 80 Quadratmeter Keller, je 50 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei Etagen – das Maximum, das das Kleingartengesetz seit einer Novellierung im Jahr 1992 zulässt.
Dieses Jahr hat das Leben im Kleingarten für immer verändert. Denn damals hat die Gemeinde nicht nur den Ausbau, sondern auch das ganzjährige Wohnen im Kleingarten und den Kauf der Parzellen ermöglicht.
Der damalige Wiener Planungsstadtrat, Hannes Swoboda (SPÖ) wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Er wollte legalisieren, was bereits seit Jahren Realität war – den wilden Bau viel größerer Häuser und das unerlaubte ganzjährige Bewohnen vieler Kleingärten.
Gleichzeitig hoffte Swoboda mit der Kaufmöglichkeit die Wiener Wohnungsknappheit zu lösen – tausende Kleingärtner würden auf ihre Stadtwohnungen verzichten und Platz machen, glaubte er und bekam Beifall von ÖVP und FPÖ. Lediglich die Grün-Alternativen waren dagegen, sie bezweifelten, dass die Leute ihre Wohnungen räumen würden.
Die Grünen behielten recht. Die Kleingärtner überließen ihre Wohnungen ihren Kindern und nicht dem Markt. „Einen schweren Fehler“ nennt Ferdinand Kovarik die Entscheidung von vor 30 Jahren.
„Die öffentliche Hand hat keine Grundstücke zu verkaufen. Man verschleudert nicht das Familiensilber zu einem Spottpreis an ein paar.“ Der Verkauf der Berliner Sozialwohnungen nach der Wende sei das beste Beispiel, sagt Kovarik und klopft sich so fest auf den Oberschenkel, dass seine Yorkshire-Terrier-Mischlingshündin Dina einen Satz macht. Auf den Verkauf folgte Wohnungsmangel, die Mieten stiegen. Darunter leide Berlin bis heute.
Ferry Kovarik war sein ganzes Leben lang Sozialdemokrat: als Kind bei den roten Falken, dann in der sozialistischen Jugend. In der Partei stieg er auf: vom Installateur bei den Gaswerken zum Leiter einer Bürgerdienst-Stelle zum Personalvertreter und später zum Bezirksrat.
Er bekam das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien und war jahrelang Obmann des Kleingartenvereins Waidäcker. Eine Bilderbuch-Parteikarriere. Trotzdem ist Kovarik mit der SPÖ so unzufrieden, dass er seit gut 15 Jahren keine Beiträge mehr zahlt. Auch wegen des Verkaufs der Kleingärten, wie er sagt.
Doch wie hält er es eigentlich selbst damit? Bewohnt er das Haus auf dem alten Grundstück seines Onkels nach wie vor zur Pacht? Anders als seinen drei Söhnen, die ebenfalls Kleingärten im selben Verein besitzen, gehöre ihm gar nichts. Und er fügt hinzu: Den Kleingarten seines Onkels, den habe seine Frau gekauft. Eine wienerisch anmutende Lösung für den Gewissenskonflikt.
Spricht man Sylvia Wohatschek auf Wiener Kleingarten-Dynastien an, verdreht sie nur leicht die Augen. Den Vorwurf, sie und ihre Familie hätten es sich gerichtet, habe sie schon so oft gehört, dass er sie nicht mehr kränkt. Sylvia Wohatschek, 44, ist nämlich die Tochter von Wilhelm Wohatschek, dem Präsidenten des Zentralverbands der Kleingärtner und Siedler Österreichs. Seit 1987 leitet er von seinem Amtssitz in der Leopoldstadt aus die Geschicke der meisten Kleingartenvereine des Landes.
Mitte der 1990er-Jahre hat ihr Vater für sie das grün gestrichene Haus auf die Parzelle im Kleingartenverein Ettenreich gebaut – ihrer älteren Schwester ein fliederfarbenes nebenan.
Mit 19 ist Sylvia Wohatschek von der elterlichen Wohnung in der Per-Albin-Hansson-Siedlung in den Kleingartenverein gezogen. „Ich kann verstehen, dass uns manche Leute deswegen kritisieren, aber wir bezahlen unsere Pacht wie alle anderen. Mein Vater hat gemeint ‚jetzt habe ich schon so vielen Politikern und anderen Leuten geholfen, einen Garten zu bekommen, jetzt kann ich ja wohl auch meinen Kindern helfen‘.“
Die Vereine, sprich die Obmänner, haben seit jeher das Recht, Pächter vorzuschlagen, weshalb Kleingartenparzellen lange Zeit unter Sozialdemokraten und ihren Freunden wie Zuckerln verteilt worden waren. Mit dem Verkauf der Gärten habe die ÖVP Anfang der 1990er-Jahre die rote Macht des Zentralverbandes brechen wollen, glaubt Wilhelm Wohatschek. „Dabei waren für mich in 34 Jahren als Präsident Parteizugehörigkeiten wurscht“, sagt er.
Nur wegen des politischen Drucks der ÖVP habe der Wohnbaustadtrat Hannes Swoboda damals die Kaufoption eingeführt. Die Schwarzen hätten bereits zu jener Zeit vorgeschlagen, die Wiener Gemeindebauten und Kleingärten zu verkaufen. Bei den Kleingärten sei die Stadt eben eingeknickt.
Für Sylvia Wohatschek war die Kindheit als Tochter des Zentralverbandspräsidenten aber nicht nur ein Zuckerschlecken: „Meine Schwester und ich hätten uns so sehr einen richtigen Urlaub gewünscht. Aber wir haben jedes Wochenende und alle Ferien im Kleingarten unserer Eltern in Essling verbracht. Ausnahmslos“, erzählt die Soziologin. Seit 15 Jahren arbeitet auch sie im Zentralverband der Kleingärtner, sie leitet dort die Versicherungsabteilung.
„Endlich“, sagt ihr Vater, Wilhelm Wohatschek. Endlich habe die Stadt den Ausverkauf der Schrebergärten gestoppt. Der 78-jährige ehemalige Elektroingenieur sei „nie“ für den Verkauf von Kleingärten gewesen. „Der Pachtvertrag ist so sicher, der Zins so niedrig – warum besitzen?“ In den vergangenen Jahren sah er schon das ganze System der Wiener Kleingärten aus dem Ruder laufen. Weil einige großes Geld machten.
„Da melden sich Leute, deren Pacht wir gerade erst aus unserem Sozialfonds beglichen haben, weil sie nicht zahlen konnten, und wollen plötzlich ihr Grundstück kaufen – klar steckt da eine Immobilienfirma dahinter, die bereit ist, hunderttausende Euro hinzulegen.“
Er spüre es, sagt Wohatschek, dass heute schon 40 Prozent der Städtischen Kleingärten in Privateigentum sind. „Die Stimmung in den Anlagen hat sich verändert.“ Das Miteinander habe gelitten. Zwar gebe es noch Vereinsaktivitäten und Feste, viele Eigentümer würden aber dem Verein nicht beitreten und keine Verantwortung und Kosten für die Gemeinflächen übernehmen wollen. „Zwingen können wir sie schwer.“
Heute weht in den meisten Kleingartenanlagen ein anderer Wind. Viele der Neuzugezogenen können mit der Vereinsstruktur, mit ihren Beiräten und Fachgruppen, Ausschüssen und Gangwarten nichts mehr anfangen. Das liegt auch am Generationenwechsel in den Schrebergärten: Jungfamilien und junge Pärchen ziehen zu. Hackler und Anwälte teilen sich plötzlich eine Hecke.
Politisch gesehen zog sich das rote Paradies immer mehr blaue und türkise Flecken zu – in einigen Kleingartenvereinen hatten bei den vergangenen Wahlen die ÖVP oder FPÖ die SPÖ vom ersten Platz verdrängt. In anderen legten die Grünen zu. Der Kleingarten als natürliches SPÖ-Habitat wackelt.
Der Wiener Stadtplaner Reinhard Seiß sprach kürzlich mit der Wiener Zeitung über den „Sündenfall der Wiener Planungspolitik“: das Zerstückeln großer Flächen in Bestlage, um sie an Häuslbauer zu verkaufen.
Das Argument sei alt, winkt Präsident Wohatschek ab. Deshalb seien in den vergangenen zehn Jahren, in denen die Grünen die Stadtplanung verantworteten, keine neuen Flächen für Kleingärten gewidmet worden. Dabei würde der Zentralverband über reichlich Grund für neue Anlagen verfügen. Es fehle nur die richtige Widmung, um sie errichten zu können.
Tatsächlich hatte Wiens ehemalige grüne Planungsstadträtin Maria Vassilakou nie einen Hehl daraus gemacht, wie ihr Wien der Zukunft aussehen sollte: eine verdichtete Stadt der kurzen Wege. Sie wolle keine „Monsterbauten“ vor schmucke Einfamilienhäuser stellen, sagte Vassilakou 2011 bei einem Treffen mit Bürgerinitiativen in der Donaustadt, aber eine Stadt aus Einfamilienhäusern wolle man auch nicht haben.
Nun, da die neue Planungsstadträtin Ulli Sima heißt und das Ressort erneut in roter Hand ist, besteht Hoffnung, dass der Zentralverband die gewünschten Widmungen bekommt und neue Kleingärten entstehen. Aus dem Büro der Wohnbaustadträtin Katrin Gaál heißt es zumindest einmal, die Schaffung neuer Flächen sei eine Option.
Zwar mögen Kleingärten in Zeiten des Klimawandels, wie Wilhelm Wohatschek einwirft, gut für das lokale Mikroklima sein, in Sachen Bodenversiegelung und Zersiedelung sind Einfamilienhäuser – selbst mit einer Grundfläche von nur 80 Quadratmetern – stadtplanerischer Anachronismus.
Doch der Traum vom eigenen Garten lebt hoch – seit Beginn der Pandemie kann sich der Zentralverband der Anfragen kaum erwehren.