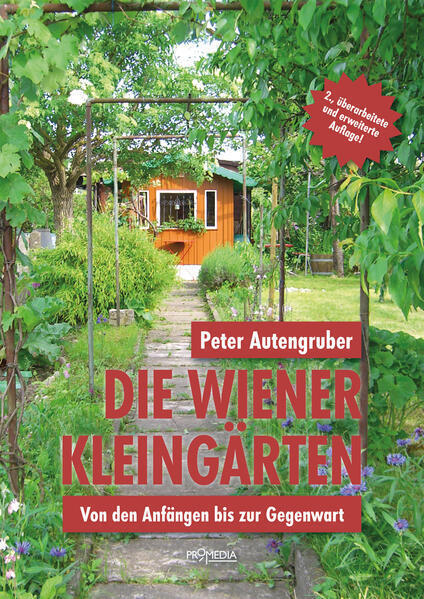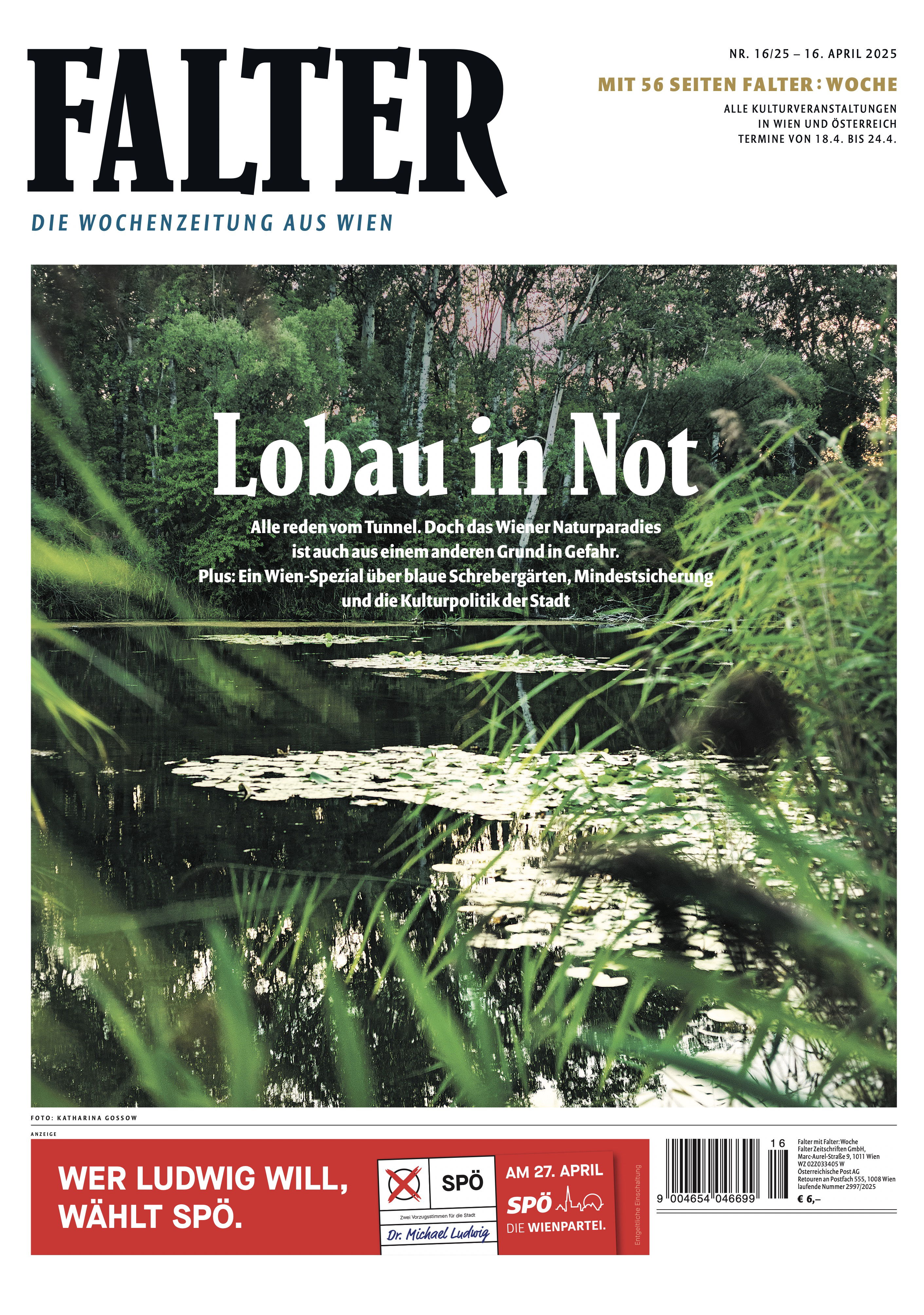
Verraten im Garten
Matthias Winterer in FALTER 16/2025 vom 16.04.2025 (S. 14)
Früher war klar: Wer einen Kleingarten hatte, wählte rot. Das ist vorbei. In den Parzellen regieren die Blauen. Und die Freunderlwirtschaft roter Wiener Bezirkskaiser
Da war sogar Ernst Nevrivy schmähstad. Der Bezirkskaiser der Donaustadt, sonst nie um eine Pointe verlegen, verstummte. Im Herbst 2023 schlug in Wien die Kleingartenaffäre ein. Und ausgerechnet er, der leutselige Sprücheklopfer der Wiener SPÖ, war mittendrin.
Eine Parzelle in bester Lage hatte er sich gekrallt. Kurz darauf: die lukrative Umwidmung. Plötzlich war das grüne Fleckerl Gold wert.
Die Nachricht sprach sich schnell herum. Zeitungen berichteten, im Fernsehen diskutierten Korruptionsexperten, in den Beiseln ging den Wienern das G’impfte auf. „Eh klar“, hieß es, „die da oben können es sich richten.“ Nevrivy, der joviale Kümmerer, wurde über Nacht zum Bonzen, der sich zuerst um sich selbst kümmert. Und die SPÖ? Die sah dabei zu, wie ein Kleingarten die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokratie ins Rutschen brachte. Im Kleingarten verspielten die Roten ihren Kredit. Wieder einmal.
Die Wucht der Affäre erklärt sich nicht durch das Was, sondern durch das Wo. Inserate, Schmiergeld, Parteibuchwirtschaft – das alles hatte man den Sozis immer wieder durchgehen lassen. Aber Kleingärten? Da hört sich in Wien der Schmäh auf.
Der Wiener Kleingarten ist nicht einfach ein Stück Wiese, er ist ein Seismograf für den Zustand der SPÖ. Fühlen sich die Leute unterstützt von der Partei oder verraten? Im Kleingarten kann man es sehen. Hier jätet die einstige Parteibasis, die Hackler, Beamten und Angestellten der Stadt. Und genau deshalb ist der Nevrivy-Skandal so unangenehm für die Wiener Roten. Er unterspült die Fundamente der Arbeiterbewegung. Denn für einen Wiener war ein Kleingarten die längste Zeit mehr als eine Immobilie, er war Heimat, proletarische Tradition und ein Kaninchen in der Not.
245 Kleingartenvereine verteilen sich quer über die Stadt. Sie tragen bezaubernde Namen: Himmelteich, Rosental, Sonnenschein, Gut Freund, Neu-Brasilien, Frohsinn, Maulwurf oder Knödelhütte. Gemeinsam sind die 36.000 Parzellen so groß wie ein kleiner Bezirk.
Auf einer lebt Waltraud, 63 Jahre, kurz geschnittene Haare, die Gartenhandschuhe voller Erde. Den Namen ihres Kleingartens in der Wiener Donaustadt möchte sie nicht in der Zeitung lesen. „Im Garten wird viel getratscht, und ich will nicht, dass die Nachbarn auch über mich reden“, sagt sie und wirft Willi eine Nacktschnecke zu. Willi und Henriette, zwei Laufenten, fressen Frau Waltraud die Mollusken weg. Im ganzen Garten hat sie Gemüsebeete angelegt.
Noch ist die Erde braun, schon bald werden Gurken, Tomaten, Zucchini, Radieschen und Rucola wuchern. „Wenn die Enten ihre Arbeit tun“, sagt Frau Waltraud und lacht.
Sie dämpft ihre Zigarette aus und bittet ins Haus. Hinter dem Flur eine gemütliche Wohnküche, viel Holz, Tonfliesen, ein Traumfänger hängt an der Wand. Ein warmer Raum. Frau Waltraud räumt Ringmappen vom Tisch. „Das ist auch eine Kanzlei“, entschuldigt sie sich. An der Adresse hat sie ihre Firma angemeldet, eine Steuerberatung. Viel macht sie nicht mehr, die meiste Zeit steht sie im Garten.
Frau Waltraud ist die Repräsentantin einer aussterbenden Art im Kleingarten: Sie ist Sozialdemokratin. Aus Überzeugung, wie sie sagt. Und ihre Überzeugung gibt sie auch wegen Ernst Nevrivy nicht auf. „Was mich an der Sache stört, ist, dass der Bezirksvorsteher so schnell an ein Grundstück gekommen ist. Da stimmt doch was nicht.“ Sie selbst habe jahrelang warten müssen, bis sich ihr Traum vom Garten erfüllte.
Um die Wiener Kleingärten ist ein Griss, wie man in der Hauptstadt sagt, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Die Wartelisten für Pachtgründe haben absurde Längen erreicht, unter fünf Jahren geht nichts, wenn überhaupt etwas geht. Offizielle Aufnahmekriterien gibt es nicht. Die Vereine entscheiden selbst, wer dazugehört. Genau genommen entscheidet das der Obmann. Und der will den Bewerber erst einmal sehen, am besten im Schutzhaus bei einem Bier. Er macht die Tür nur für jene Leute auf, die vorher ordentlich angeklopft haben. Oder gezahlt.
Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich auch einkaufen, zumindest in den privaten Anlagen. Die kommunalen Gärten verkauft die Stadt schon seit 2021 nicht mehr. Nevrivy schlug am idyllischen Schotterteich zu. Das Grundstück erwarb er vom Zentralverband der Kleingärtner, jenem Verband, der als Generalpächter auch für die rund 13.000 kommunalen Parzellen der Stadt Wien zuständig ist. Einen schlanken Fuß macht das nicht.
Die Tür stand für den Bezirksvorsteher sperrangelweit offen, weil er dem Verein Vorteile in Aussicht stellte – zumindest erhoffte das der Verein. Aber das kam nicht gut an bei jenen, die auch gern einen Kleingarten hätten. Vordrängler sind in Wien ungefähr genauso beliebt wie Schwarzkappler. Und gegen Bezirkschef Nevrivy – der sich in einer anderen Immobilienaffäre bereits wegen der Beihilfe zur Untreue und Geschenkannahme verantworten muss – wird nun auch wegen Amtsmissbrauchs ermittelt.
Meistens bleibt das Tor zur Kleingartenanlage für Fremde ohnehin zu. Stirbt ein Kleingärtner, übernehmen die Kinder. Dann die Enkel. Während Wien wächst und ächzt unter dem zunehmenden Zuzug, bleiben die Kleingärtner unter sich. Migrationsprobleme? Nicht im Garten.
Offizielle Zahlen zur Herkunft der Wiener Kleingärtner gibt es nicht. Niemand weiß, wie hoch der Anteil der Migranten ist. Auskunft gibt nur Frau Pfleger. „Hier gibt es keine Ausländer“, sagt sie, das Kopftuch tief ins Gesicht gezogen, offene Winterjacke, Schlapfen. Frau Pfleger, in Favoriten aufgewachsen und immer in Favoriten geblieben, steht an einem Maschendrahtzaun im Kleingartenverein Blumental am äußersten Rand des Bezirks.
Der Wind trägt das Rauschen der Südosttangente über die 417 sauber separierten Parzellen. Frau Pfleger kennt die Anlage, seit sie denken kann. Schon als Kind löste sie hier mit ihrem Opa Erbsen aus. In den späten 70er-Jahren überschrieben ihr die Eltern den Pachtvertrag, längst hat sie das Grundstück gekauft. „Ich habe die Wohnung im Gemeindebau vor 15 Jahren aufgegeben und bin in den Garten gezogen“, sagt sie. „Ich musste fliehen. Vor den Ausländern.“ Der Kleingarten als vermeintliche letzte Schutzzone in einer sündigen Stadt.
Sie liegt hinter Thujenhecken, Wänden aus Gabionen und elektrischen Einfahrtstoren. Hier lässt sich die echte Welt fabelhaft aussperren. Das wusste schon Bruno Kreisky.
Im Winter 1983 saß der alternde rote Kanzler im Schnellzug nach Linz. An seiner Seite der junge Arbeiter-Zeitung-Redakteur Herbert Lackner. Das Ziel der Wahlreise: die Voest. Kreisky, schon deutlich gezeichnet, lehnte am Fenster – so erzählt es Lackner heute – und dachte über die vorbeiziehenden Hütteldorfer Kleingärten nach. Als junger Sozialdemokrat habe er die Schrebergärten abgelehnt. Diese kleinbürgerliche Welt spieße sich doch mit den Idealen des Roten Wien. Die Abgrenzung, der Rückzug, die mangelnde Solidarität, das passte doch nicht zu einer internationalen Bewegung. Politisch komme man an diese Leute auf Dauer nicht mehr heran.
Kreisky sollte recht behalten, doch erleben durfte er das nicht mehr. Damals in den 1980er-Jahren war die rote Welt in den grünen Gärten noch heil. Keine Erschütterungen, keine Ausreißer, die Nadel des Seismografen ruhte. An den Wochenenden tankten die Arbeiter in den Kleingärten der Stadt ihre Kraft, vor sich das Bier auf dem Gartentisch, das Lusthäuschen im Rücken. Die Verwaltung erlaubte damals noch keine größere Bebauung. Die Kleingärtner waren Stammwähler der SPÖ, einer Partei, der sie viel zu verdanken hatten: die Wohnung im Gemeindebau, die Rechte am Arbeitsplatz, den geschobenen Posten in der Gemeinde – und natürlich den Garten.
Die Wurzeln der Wiener Kleingärten liegen gar nicht in Wien, sondern im niederösterreichischen Purkersdorf. Dort gründete eine kleine Gruppe von Philanthropen, Lebensreformern und Vegetariern im Jahr 1904 den „Wiener Naturheilverein“. Sie kauften große Liegenschaften an und vergaben sie an Gleichgesinnte. Die „Grasfresser von Purkersdorf“, wie sie bald genannt wurden, pflanzten ihre Idee später nach Wien aus.1911 gründete Julius Straußghitel den ersten Wiener Kleingartenverein in Penzing.
Korruption? Gab’s schon damals. Eine Pächterin in der neuen Anlage war die Tochter des christlichsozialen Vizebürgermeisters Heinrich Hierhammer. Der Papa hat’s dem Verein kräftig gerichtet, wie der Historiker Peter Autengruber in seinem Buch „Die Wiener Kleingärten“ schreibt. Der prominente Politiker half mit Subventionen aus, 500 Kronen pro Jahr. Er organisierte sogar einen Anschluss an die Wiener Hochquellleitung. Die Roten hatten mit dieser Freunderlwirtschaft aber nichts zu tun.
Im Ersten Weltkrieg breiteten sich die Kleingärten explosionsartig aus, die Not des Krieges zwang zur Selbstversorgung. Ihren Höhepunkt erlebte die Bewegung in den 1920er-Jahren. Die Leute flohen aus den Elendskasernen in die gezimmerten Hütten am Stadtrand – aus Mangel an Arbeit, Brennholz und Nahrung. Historiker Autengruber zählt zu Kriegsbeginn 1914 nur rund 500 Kleingärten in Wien. Sieben Jahre später sind es 30.000.
Für die Stadtregierung war das eine Gratwanderung. Die „wilden Siedlungen“ waren nicht legal, aber ein Politikum. Die Stadtväter wollten die Arbeiter, Arbeitslosen und Kriegsinvaliden aus den Gärten nicht verlieren. Also tolerierten sie die illegalen Siedlungen. Nur wer allzu dreist auftrat, bekam einen Verweis. Als die Siedler sogar den Lainzer Tiergarten für großflächige Gartenanlagen roden wollten, stellte sich die Stadt dagegen.
Dann kam Jakob Reumann. Als am 3. April 1921 Kleingärtner vor dem Wiener Rathaus demonstrierten, versprach der erste rote Bürgermeister Hilfe – und hielt Wort. Im Juli legte die Stadt erstmals Kleingartenzonen im Flächenplan fest. Bis 1938 stellte Wien den Kleingärtnern rund fünf Millionen Quadratmeter öffentlichen Pachtgrund zur Verfügung.
Die Kleingärten wurden zur Identität des Roten Wien. Die Kleingärtner stolze Sozialdemokraten, antifaschistisch und solidarisch. Im Ständestaat entmachtete das Dollfuß-Regime die roten Vereine und gliederte sie in die Vaterländische Front ein. Nach dem „Anschluss“ löste sie NS-Landwirtschaftsminister Anton Reinthaler, ein Linzer, per Dekret auf. Reinthaler, der 1956 erster Bundesparteiobmann der FPÖ war.
Die Blauen setzten damals noch keinen Fuß auf die Parzellen. Die Wirtschaft erblühte, Kraut und Rüben wichen Liegestuhl und Gartenzwerg; aus den lebensnotwendigen Selbstversorgerparzellen wurde eine Freizeitoase mit Planschbecken, Camping- und Tischtennistisch. Sie waren Wohlstandsinseln – zum Spott der urbanen Linken in der Innenstadt, die in den Gärten die Brutstätte der Spießigkeit sahen. Vereinsregeln, Windrädchen und getöpferte Aschenbecher statt internationale Solidarität. Kreisky hatte es geahnt.
Noch hielten die Kleingärtner zu ihrer SPÖ, der Seismograf blieb ruhig. Die Zäsur kam am 4. Mai 1992. Der Wiener Gemeinderat beschloss einstimmig das neue Wiener Kleingartengesetz. Es erlaubte, die Gärten ganzjährig zu bewohnen. 50 Quadratmeter durften auf zwei Etagen verbaut werden, im Keller sogar mehr. In den Kleingärten rückten die Bagger an. Sie rissen die zusammengenagelten Holzhütten weg. Einfamilienhäuser versiegelten das Grabeland, natürlich mit Pool und einem Trampolin über dem letzten Stück Rasen. Der Traum vom Einfamilienhaus – auf 300 Quadratmetern. Zwei Drittel aller Gärtner machen vom ganzjährigen Wohnrecht Gebrauch.
Statt Reformidee und des Geists der Siedlerbewegung herrschte auf den Parzellen der konservative Mief der Kleinhäusler. Der soziale Gedanke verdünnte sich genauso wie das Zugehörigkeitsgefühl zur SPÖ.
1993 der nächste Dammbruch. Die Stadt begann die kommunalen Gründe zu verkaufen, mit sattem Abschlag. Die Kleingärten, bisher reine Pachtgründe, konnten nun von ihren Bewohnern erworben werden, mit 45 Prozent Rabatt. 5000 Parzellen wurden bis 2021 privatisiert, aus den Gartlern von damals sind Eigentümer geworden. Der Seismograf schlug aus, das Erdbeben begann.
Was in den Gärten anfing, setzte sich in der Republik fort. Die SPÖ verkaufte. OMV, Voest, Austria Tabak, Staatsdruckerei, Flughafen Wien: All das (teil)privatisierte die Partei, auch unter dem Druck der Konservativen. Selbst die Austrian Airlines fliegt seit der Regierungszeit des roten Kanzlers Werner Faymann unter der Flagge der deutschen Lufthansa. Die SPÖ beschritt, so wie viele Sozialdemokraten Europas, den „Dritten Weg“ und entsorgte den Klassenkampf. Statt roter Werte herrschte der Shareholder Value. Viele Menschen verstanden ihre Partei nicht mehr.
Auf den Grünparzellen der Stadt war die Erschütterung zuerst spürbar. Dort, wo einst das Rote Wien erblühte, schossen erste blaue Triebe aus dem Boden. Heute sind die Kleingarten-Wahlsprengel fest in freiheitlicher Hand. Im Blumental, dem Revier der resoluten Frau Pfleger: FPÖ 31 Prozent. Himmelteich: FPÖ 30 Prozent. Simmeringer Haide: FPÖ 35 Prozent. Wasserwiese: FPÖ 35 Prozent. Die Liste ist lang und brutal.
Bürgermeister Michael Ludwig wird sich etwas einfallen lassen müssen, wenn er in den Kleingärten wieder an Boden gewinnen will. Es geht um viel. 50.000 Menschen leben in den Gärten, das ist keine Massenbewegung, aber mehr, als in Hernals wohnen.
Mit Bruno Kreisky würde Ludwig wohl streiten. Der Altkanzler hielt Abstand zu den Gärten, er lebte ja in einer Villa mit Park – vermietet von der Wiener Städtischen. Ludwig aber ist selbst Kleingärtner. Und als solcher hat er in den Garten- und Parteifreund Nevrivy „vollstes Vertrauen“. Die Staatsanwaltschaft setzt lieber auf Kontrolle.