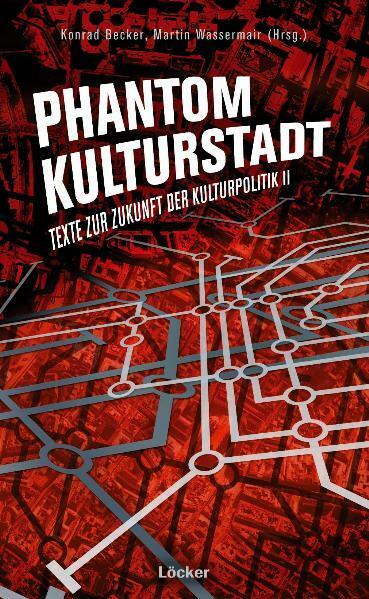Ohne Lobby ist es Hobby
Matthias Dusini in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 22)
Wie leben und arbeiten Künstler in Wien? Ein Besuch bei Unternehmern und Bohemiens
In dem Atelier hinter der Karlskirche arbeiten die Assistenten. "Da, halt mal!", fordert der griechische Künstler Jannis Varelas, Jahrgang 1977, eine junge Kollegin auf, die gerade mit dem Bleistift an einem seiner Bilder herumzeichnet. Nun soll sie ein bereits gerahmtes Bild vorführen, ein bärtiges Fantasiewesen darstellend, aus dessen Hose zwei Schwänze wachsen.
Das Bild entstand vor drei Jahren im Projektraum einer Galerie, erzählt Varelas. Auf deren Einladung verbrachte er einige Monate in Wien, dann beschloss er, nach vier Jahren in London nach Wien zu ziehen. "Die Vibes sind gut hier, und man trifft in den Lokalen Leute, ohne sie vorher anrufen zu müssen."
Varelas ist einer jener Künstler, die an der Ausstellung "Lebt und arbeitet in Wien III" teilnehmen. Seine Heimat ist das iPhone, in dem die Kontakte zu Freunden in London, Athen und New York gespeichert sind. Er gehört zu einer mobilen Künstlergeneration, die den Wohnort nach pragmatischen Kriterien aussucht. Stimmen die Mietpreise, die Galerien, die Clubs, die Ausstellungen? Zu den Messen nach London und Basel gibt es Billigflieger.
Varelas schützt sich mit einem dicken Schal gegen die Kälte in dem Kelleratelier. Im Juni düst er dann in die Ägäis, eine mehrmonatige Schaffenspause beginnend. "Bei 40 Grad kann man nicht arbeiten." In dem geräumigen Atelier ist Varelas nur Untermieter. Die Hausherrin Lisa Ruyter braucht die großen Wände.
Die 40-jährige Amerikanerin lebt seit sieben Jahren in Wien, wo sie 1994 ihre erste Ausstellung überhaupt hatte. "Das war schon seltsam damals, als würde man durch ein Museum gehen. Aber irgendwie auch gut", erinnert sich die Künstlerin, die mit ihrer figurativen Malerei bei Sammlern gut ankommt.
An der Wand lehnen grundierte Leinwände, der Assistent koloriert ein Gruppenporträt, das eine Szene am Rand einer Modenschau darstellt. Ein Heizstrahler verbreitet etwas Wärme.
Die Bilder gehen an eine Galerie in Südkorea, deren Angebote die Künstlerin zunächst ablehnte. "Die waren mir eine Spur zu aggressiv." Sie sollte 25 vorab bezahlte Gemälde an einen ihr unbekannten Ort schicken. Bei einem Besuch in Daegu überzeugte sie sich von der Seriosität der Geschäftspartner. "Ich glaube, sie sehen mich in der Nachfolge von Popkünstlern wie Andi Warhol und Alex Katz."
Die Malerin, deren Bilder zwischen 27.000 und 55.000 Euro kosten, fühlt sich wohl in Wien. Anders als in den USA müsse sie nicht ständig an die Krankenversicherung denken. Nach Jahren des hektischen Reisens habe sie hier zur Ruhe gefunden, verbringe viel Zeit im Studio.
An der Wand lehnt ein sieben Meter langes Bild mit psychedelisch durcheinander gewirbelten Nationalflaggen, das an das modernistische Grafikdesign von Propagandabildern erinnert. "In New York hätte ich es mir nicht leisten können, so ein Bild ohne Auftraggeber zu malen." Lisa Ruyter nennt das Freiheit.
Ihr Einstieg in Wien war kein Atelier, sondern eine eigene Galerie. "Eigentlich sollte es eine Art Punkding sein: eine Galerie, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen und ohne mehr als drei Leute zu kennen." Doch es war vom ersten Tag an ein normaler Galeriebetrieb, "zu ernst". Nun konzentriert sie sich wieder auf das Kerngeschäft.
Mit ihrem Do-it-yourself-Ethos gehört Lisa Ruyter zu einem neuen Typus von Künstlern, die nicht mehr warten, bis ein Kurator oder ein Galerist hereinschneit. Statt mit der Mappe Galerien abzuklappern, stellt sie ihr Portfolio ins Netz.
Selbstorganisierte Räume wie das weisse haus, Ve.Sch oder Magazin geben Studienabgängern eine Chance. Fanzines wie Eine oder Rokko's Adventures müssen sich an keine Zielgruppenanalysen halten. Ob dieser Vielzahl von Möglichkeiten findet es Ruyter unverständlich, wie wenig selbstbewusst die lokale Kunstszene selbst manchmal über sich spricht.
Ihre letzte Ausstellung in der Galerie Georg Kargl Fine Arts bestritt sie mit Bildern von einer Pressekonferenz im Wiener Uno-Gebäude, bei der eine wichtige Meldung über Nuklearwaffen bekanntgegeben wurde. Ruyter war erstaunt, dass die Wiener von der großen, internationalen Behörde kaum Notiz nehmen. Eine ähnliche kognitive Dissonanz sieht sie im Verhältnis zwischen Stadt und zeitgenössischer Kunst: "Sie ist nicht Teil der lokalen Identität."
Tatsächlich ist es in der internationalen Kunstwelt nicht besonders sexy, aus Wien zu sein. Um politische Anliegen in der Kunst glaubwürdig zu vermitteln, ist es besser, "geboren in Sarajevo" oder "geboren in Lagos" in den Lebenslauf schreiben zu können. Mitunter kann sich, wie im Fall der Leipziger Malerschule oder der Young British Artists, die geografische Herkunft zu einer Corporate Identity entwickeln.
In den Arbeiten von Wiener Künstlern aber spielt der Ort kaum eine Rolle, selbst Bezüge zu Ikonen der Kunstgeschichte wie den Wiener Aktionisten kommen nicht vor. Man will global und international sein, Wien ist einem peinlich wie spießige Eltern. Der Coolnessfaktor zieht Künstler nach Berlin, ohne dass diese Stadt eine mit Wien vergleichbare Infrastruktur hätte.
Hier aber gibt es staatliche Stipendien und die vom Wiener Wirtschaftsförderungsfonds eingerichtete kommunale Stelle Departure, die Gelder für Offspaces, Musiklabels und Gastateliers zur Verfügung stellt. Von den Tourismus- und Wirtschaftsplanern wird die kreative Szene als Standortfaktor wahrgenommen.
Nicht bei allen Künstlern verläuft die Grenze zwischen Unternehmertum und bohemesker Unterschicht so klar ersichtlich wie bei Ruyter: Das durchschnittliche Jahreseinkommen österreichischer Künstler liegt bei 4500 Euro netto. Für sie gilt: Ohne Lobby ist es Hobby.
Kathi Hofer hat kein Atelier. Das Werk der 28-jährigen Künstlerin und Philosophin hat auf dem Küchentisch Platz. Die kleine WG-Küche in Margareten hat einen Blick auf einen begrünten Hinterhof, hier sitzt sie oft mit einem Buch. "Lesen macht einen Großteil meiner künstlerischen Arbeit aus."
Um einen Eindruck davon zu bekommen, muss man in ein Hinterzimmer der Kunsthalle gehen, wo sie einen Zaubertisch aufgebaut hat. Ein Zaubertisch ist ein Tisch mit einem golden gerasterten, schwarzen Tuch, unter dem Magieprofis gewöhnlich Objekte verschwinden lassen. Hofer arrangierte darauf ein Exemplar von Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften", das Foto von einem Zaubertrick und eine der Bildillusionen M.C. Eschers, dazu zu Origamis gefaltete Buchseiten.
Sie erzählt von ihrer Auseinandersetzung mit den Surrealisten und deren Malereitricks. Und der von Musil dargestellten politischen Repräsentationskrise und der Macht der Bilder in der gegenwärtigen Informationsflut. Der Raum ist dunkel, eine Tischlampe beleuchtet das papierene Stilleben geheimnisvoll. Harry Potter trifft René Magritte.
Anspielungsreich, belesen und antispektakulär gehört Hofer zur Wiener Schule der Diskurskunst, die an der Akademie der bildenden Künste eine universitäre Verankerung hat. Mit ihrer Arbeitsweise siedelt sie sich an jenem Pol des künstlerischen Feldes an, der auf symbolischer Anerkennung gründet. Nicht Sammler, sondern Leser sind ihre Lobby. Das Geld kommt irgendwann einmal, oder auch nicht.
Neben dem Studium arbeitete Hofer auch bei der Kunstzeitschrift springerin, Wiens erster Adresse in Sachen Theorieimport. Im Sommersemester will sie ihr Studium abschließen, dann aber auch weiterhin Ausstellungen machen und theoretische Aufsätze schreiben. "So kann ich kompromissloser sein und muss mich nicht so sehr den Marktmechanismen fügen."
Hofer schätzt Ausgehorte wie das Fluc oder die Bar des Theaters brut, an denen das Reden und Trinken sich produktiv mit der künstlerischen Arbeit verknüpft, "Dinge entstehen können". In dem von Martin Vesely betriebenen Offspace Ve.Sch plant Hofer demnächst eine Ausstellung, der
erste Abend ist für die Vernissage, weitere für Konzerte und Performances vorgesehen.
"Die Arbeitsweisen und Genregrenzen verschwimmen", beschreibt die Künstlerin die Heterogenität der jungen Szene. "Es gibt wenige Kollegen, die sich streng als Konzeptkünstler oder Maler positionieren."
Einer ist stolz darauf, selbstständig zu sein, ohne Unternehmer zu werden: Rudolf Polanszky, mit 58 Jahren der älteste Newcomer der Ausstellung. "Keine Ahnung, wer das eingefädelt hat", sagt der Künstler. Möglicherweise habe ihn Kunsthallen-Direktor Gerald Matt bei einer Gruppenausstellung in Athen gesehen. Jedenfalls zeigte der sich plötzlich an ihm, dem "alten Knacker", interessiert.
Polanszky fand in einem Biedermeierhaus mitten im ersten Bezirk vorübergehend eine Bleibe, die Künstler der Gruppe Mahony sind seine Nachbarn. Eine Immobilienfirma lässt Künstler hier wohnen, bis die letzten Mieter ausgezogen sind und die Luxusrenovierung beginnen kann. "Wenn der Scheiß beginnt, müssen wir wieder raus."
Polanszky gehört zu jener Boheme, die in
den späten 60ern begann, die Wiener Kunstszene aufzurollen. Der Gastronom und Galerist Kurt Kalb, die Künstler Franz West und Diter Roth und der Dichter Reinhard Priessnitz gehörten zu seinen Freunden.
Sein Prekarium schaut aus, als wäre damals hier das letzte Mal eine Party gefeiert worden; der schöne Kreuzparkettboden ist mit grauer Ölfarbe zugeschmiert. "Ich bin völlig unbekannt, worüber ich auch froh bin. Sonst hab i koa Ruah", sagt der Künstler. Das seidene Stecktuch in der Lederjacke verrät einen Hang zur modischen Selbststilisierung. Die seit 40 Jahren verteidigte Selbstständigkeit formuliert er so: "Ich bin ein Privater."
An der Wand hängen abstrakte Bilder, die aus schmutzigen Farben, mit Plastikfolien, Styroporbrocken und Alufolie gemacht sind. Die Bildsprache lässt sich der informellen Malerei der 50er-Jahre zuordnen. Ihn habe immer interessiert, ob es sich bei ihr um Schmiererei handelt, wie manche höhnten, oder um einen versteckten Code, den man knacken kann. "Ich habe nie an den Geniegestus geglaubt."
Als Idealist lehnt Polanszky jede Anpassung – er verwendet Darwins Begriff "adaptation" – ab. Ein Akademiebesuch kam daher genauso wenig infrage wie eine Teilnahme am sozialdarwinistischen Kunstbetrieb. "Man müsste sich anbieten, sich anstellen: furchtbar!"
Er blättert im einem dicken Katalog, einem handkopierten natürlich, und erzählt von einer seiner Videoarbeiten: Da spielt er einem Hund auf der Flöte vor, dessen Gehirnströme gemessen und in eine Musiknotation übersetzt werden, was wiederum dem Künstler als Vorlage für weiteres Getröte dient. "Alles, was wir wahrnehmen, ist von uns selbst erfunden", erklärt er dieses dadawissenschaftliche Experiment.
Der inzwischen verstorbene Diter Roth ist längst ein Klassiker der Kunstgeschichte. "Man muss es wollen", sagt Polanszky. "Schau, Franz, die Müllabfuhr hat gerade deine Objekte weggeräumt", verhöhnte eine bekannte Galeristin den noch unbekannten Franz West. Sie sollte es noch bereuen: West spielt als einziger Österreicher in der Champions League der Gegenwartskunst.
Der Undergroundkünstler Polanszky hielt sich mit ein paar Verkäufen über Wasser, es ist ihm aber auch bewusst, auf was er verzichtete: "Anerkennung, Komfort, Geld." Das Gespräch endet mit Fachsimpeleien über den Holzofen in seinem niederösterreichischen Bauernhaus. Aufgrund der Kälte sei er zwangsläufig ein Saisonarbeiter.
Die Grenzen zwischen Markt und Autonomie, auch jene zwischen marktfreundlichen Gemälden und magischen Kopfgeburten sind porös geworden. Eine produktive Form der Selbstorganisation kennzeichnet die lokale Szene in der Zone zwischen Nachtleben und Galerienbetrieb. In Wien als Künstler zu leben und zu arbeiten bedeutet eine Normalität auf hohem Niveau. Man jammert leiser.