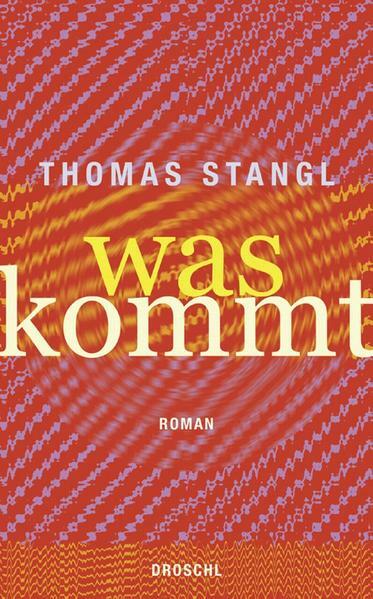Eisschollen treiben durch die Prater Hauptallee
Klaus Nüchtern in FALTER 9/2009 vom 25.02.2009 (S. 30)
Nach einem Ausflug nach Timbuktu, den Thomas Stangl in seinem Debüt "Der einzige Ort" (2004) an der Seite zweier Forschungsreisender der 1820er-Jahre unternommen hatte, kehrte er zwei Jahre danach mit "Ihre Musik" in seinen Heimatbezirk zurück, der auch Schauplatz seines jüngsten Romans ist. Für einen Ausschnitt aus "Was kommt" wurde er 2007 beim Bachmann-Wettbewerb mit dem Telekom-Austria-Preis (quasi Platz zwei) ausgezeichnet.
Es riecht sehr unschick im Karmeliterviertel: nicht nach feiner Ethnoküche, sondern nach Kohl und Kohle, Essig und Urin. Das lässt sich natürlich mit der Zeit der Handlung begründen: Der Roman spielt im Jahr 1937 beziehungsweise in den 70er-Jahren. Die Sache hat nur einen Haken: Stangl glaubt nicht an die Zeit, wie wir sie kennen: So hartnäckig wie der Kohl(en)gestank halten sich auch andere Dinge, und der ganze Roman ist eine einzige Opposition gegen die Auffassung, dass das schiere Fortschreiten der Zeit auch schon als Fortschritt anzusehen wäre: "Wie seine Großmutter lebt, so leben die alten Leute seit Jahrzehnten und Jahrhunderten", heißt es da etwa aus Sicht des Mittelschülers Andreas Bichler, dessen, nun ja, Biografie der Erzähler mit jener der 17-jährigen Emilia Degen verschränkt, die im Sommer 1937 das vaterländische Vorspiel zur Machtübernahme der Nazis erlebt und – wie man aus "Ihre Musik" weiß – auch noch Jahrzehnte später mit ihrer todkranken Tochter im Karmeliterviertel leben wird.
Als "Erzählessay" hat Sibylle Kramer in der Frankfurter Rundschau Stangls Debüt bezeichnet, und das trifft es ziemlich gut: Als plotgetrieben kann man auch "Was kommt" beim besten Willen nicht bezeichnen. Statt Handlungsstränge zu entwickeln und zu verknüpfen, arbeitet Stangl mit Konstellationen und Korrespondenzen, mit Zooms und Freeze Frames – Verfahren also, die Momente aus dem Fluss der Zeit schneiden.
Das Verb "ausschneiden" gelangt überhaupt auffällig oft zum Einsatz: Es verweist darauf, dass es abseits des Bild- und Leinwandrandes (die Bezugnahmen auf den Film sind zahlreich!) noch weiter geht. Die Totalität vermag niemand zu erfassen, aber man kann zumindest eine Ahnung davon vermitteln. Immer wieder fährt die Kamera des Stangl'schen Kopfkinos durch die Straßen und Zimmer, taucht ab ins Wasser, wo sich die ganze Pfahlstadt eines subaquatischen Venedigs befindet und eine jener Topografien imaginierten Selbstverlustes bereitstellt, der die beiden Protagonisten bedürfen: "Der Trost einer Welt, in der sie selbst nicht vorkommt".
Der kleine Gestörte und die spinnerte Frau Doktor aus dem dritten Stock – wie es aus der Nachbarn- und Hausmeisterperspektive heißt – leben beide mit ihrer Großmutter zusammen. Das ist die vordergründige Gemeinsamkeit. Während der Bub unter seinen Klassenkollegen (mit daktylisch-trochäischer Wucht immer wieder aufgerufen: "Adamek, Berger, Kernberger, Tröstl") sein Gymnasiastenelend erträgt und nur auf Flucht und Selbstverleugnung sinnt, erahnt Emma im Kreise junger Intellektueller etwas von Widerstand und Freiheit.
Der Roman selbst hingegen steht dem Pathos politischer Utopien skeptisch gegenüber. Dem Angriff der Gegenwart auf alle übrige Zeit wird durch Vergegenwärtigung des Vergangenen begegnet: Noch immer treibt das Hochwasser Eisschollen durch die Prater-Hauptallee.
"Nichts, was sich jemals ereignet hat", schreibt Walter Benjamin in seinen berühmten Thesen "Über den Begriff der Geschichte", sei "für die Geschichte verlorenzugeben". Dem würde Stangl wohl zustimmen – bei ihm heißt es so: "Das ist nicht aus und vorbei, das kommt erst."