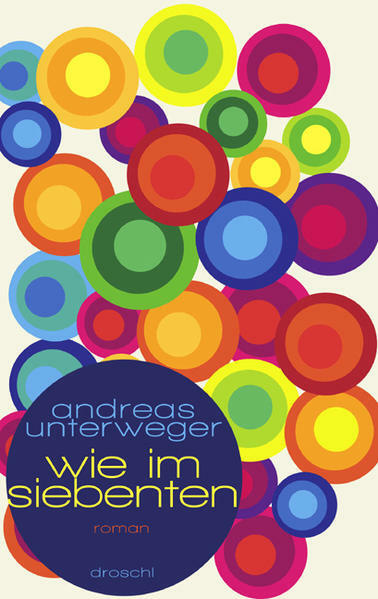Schabernack im Sprachkostüm des Understatement
Paul Pechmann in FALTER 42/2009 vom 14.10.2009 (S. 23)
In seinem Debüt zieht Andreas Unterweger Klischees der Liebesgeschichte durchs Nutellaglas
Einen Roman zu schreiben sei die einfachste Sache der Welt, behauptet Andreas, der Ich-Erzähler aus "Wie im Siebenten" im Rückblick auf seinen Erstling, der "ein ganz einfaches Buch werden" sollte, "das von ganz einfachen Dingen handelte". Keine Störgeräusche in Form von Radio, TV oder Internet drangen in sein "Schreibnest" am Fensterbrett mit Blick in einen Innenhof im siebenten Wiener Bezirk, wo er mit honiggesüßtem Kaffee und Nutellabrot gestärkt darüber schrieb, wie die Liebesgeschichte mit Judith und wie das Schreiben darüber gewesen war: "einfach nur schön".
Nicht ganz so wie in der ersten stellt sich die Erinnerung in der revidierten Fassung dar: Judith verbringt lediglich die Hälfte ihrer Zeit in Wien bei Andreas, die andere bei ihrem dreijährigen Sohn Moritz in Stein, um den sich sonst der "Exfranz" genannte Kindsvater kümmert. Eine Küretage entsorgt den Traum vom gemeinsamen Kind und was auf die kurz erwähnte Verlobung folgt, bleibt offen.
Unbestimmtheit spielt in diesem Debüt allenthalben eine wichtige Rolle. In Form exzessiver Richtigstellungen wird der Leser darüber informiert, was denn alles ganz anders gewesen sei als ursprünglich erzählt: "Natürlich hat Judith in Wirklichkeit, nie, niemals, mit der Kaffeekanne nach mir geworfen. – Aber es hat trotzdem sehr wehgetan, und die Narbe kann man heute noch ganz deutlich sehen." Über Judith selbst gibt der Erzähler nur karge Auskunft, das meiste bleibt ausgespart.
Da plappert Andreas schon lieber über Nachtfalter im Möwenpark, die von Spatzen gefressen werden, oder über seinen "Freund", den Geschirrspüler, oder darüber, wie Muscheln aus dem Nutellaglas ins Blumenkisterl gelangen. Über weite Passagen wirkt diese Erzählweise aufreizend betulich. Wenn Andreas als Erklärung zu jedem "wir" "Andreas und Judith" hinzufügt, wird aber klar: Hinter solch scheinbarer Unbeholfenheit steckt das Kalkül stilsicheren Understatements.
Noch stärker als an Forrest Gump, der im Buch einmal genannt wird, erinnert dieses Verfahren an frühe Texte Wolfgang Bauers, über den der 31-jährige Unterweger mehrere germanistische Arbeiten publiziert hat. Wie Bauer kostet der ebenfalls aus Graz stammende Unterweger den Gestus von gekünstelter Naivität gerade dann so richtig aus, wenn von der Dichtkunst die Rede ist: "Das Schreiben kam immer nur dann, wenn ich es am wenigsten erwartete."
Ähnlich wie Wolfgang Bauer besitzt Unterweger Talent zur skurrilen Komik: Das Lachen über Einfälle, wie den von der nachgeworfenen Kaffeekanne, die sich schließlich auf Andreas' Schulter niederlässt wie ein Kanarienvogel auf einem Piratenkapitän, wiegt den Verdruss über die bisweilen schale Bildersprache auf: "Wir hatten ein Loch in der Brust", heißt es da beispielsweise über die zweite Nachkriegsgeneration.
Aber womöglich zählen auch solche "Preziosen" zum Sprachkostüm eines Schelms, der seinen Schabernack bevorzugt mit vermeintlichem Tiefsinn treibt. So betrachtet stellt sich Unterwegers Text als angriffiger dar, als der Klappentext ("ungeheuer liebenswertes und charmantes Buch") uns suggerieren möchte.
Der Anspruch des Autors reicht freilich über die Satire hinaus, wie aus dem Konzept zu schließen ist, die Liebesgeschichte durch essayistische Exkurse über die "anagogische" Kraft der Liebe zu erweitern. Analog zu den Brüchen in den Künstlerbiografien von John Lennon, Dante Alighieri und insbesondere von Bob Dylan, den die Liebe zu seiner ersten Frau in mehrerer Hinsicht "elektrisierte", überschreitet der Grazer Autor in der Thematisierung "seiner" Liebesgeschichte die Formroutine einfachen Erzählens. Mit "Wie im Siebenten" serviert Andreas Unterweger ein unterhaltsam reflektiertes Debüt, in dem er die picksüß aufgetragene Liebesthematik mit ausreichend Selbstironie zu würzen versteht.