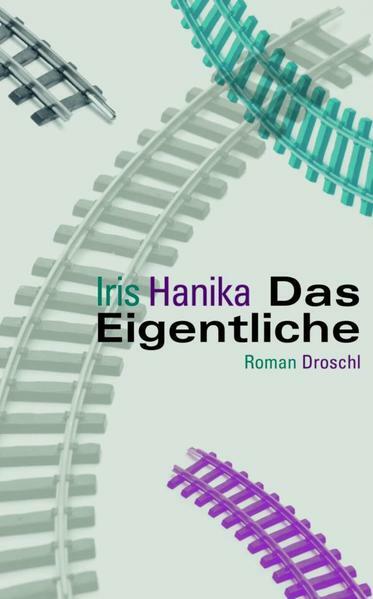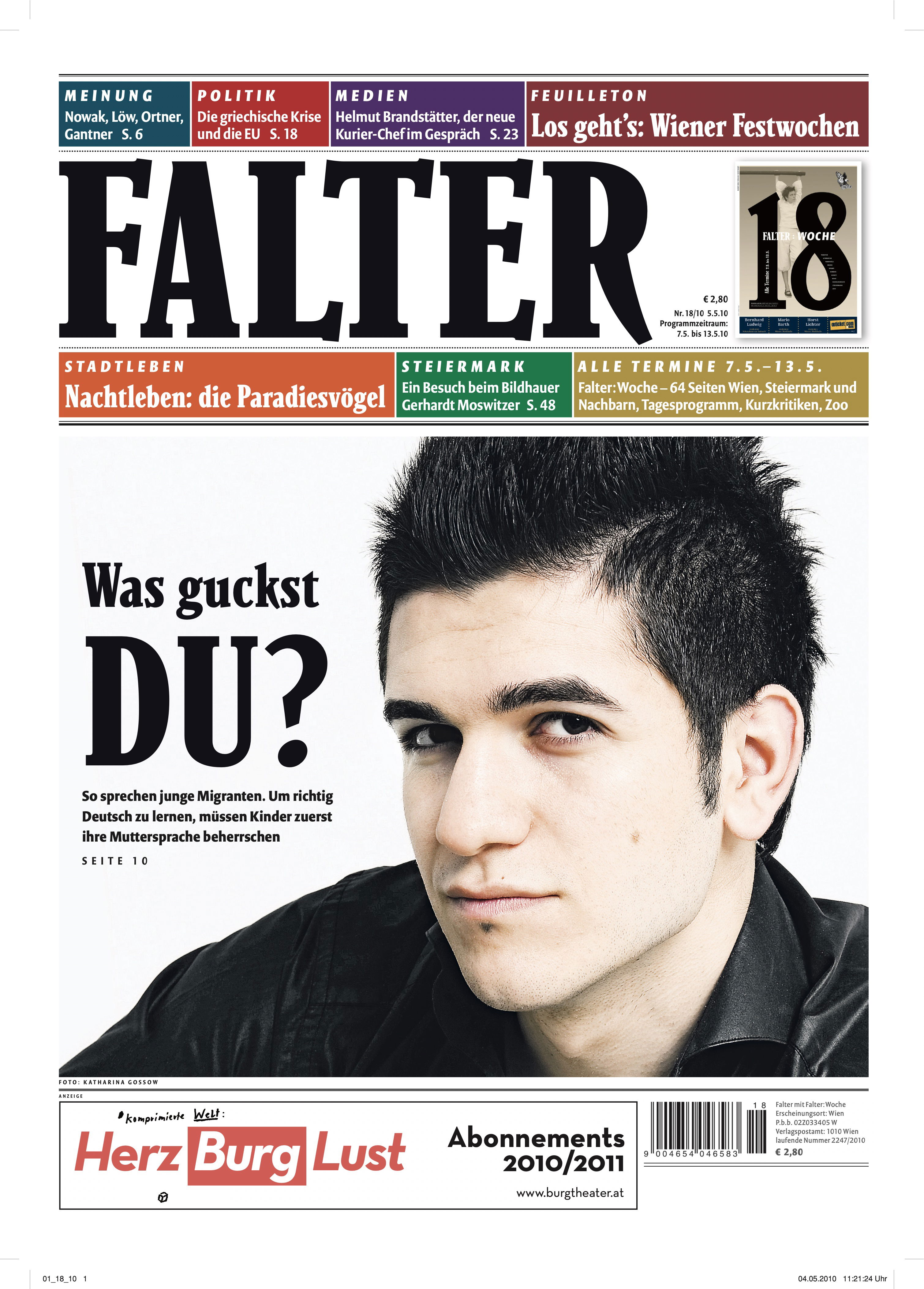
"Ich bin Tarantino unendlich dankbar"
Erich Klein in FALTER 18/2010 vom 05.05.2010 (S. 33)
Die Schriftstellerin Iris Hanika über die Sakralisierung von Auschwitz und die Hilflosigkeit des Gedenkens
Vergangene Woche war die Schriftstellerin Iris Hanika in Wien zu Gast, um aus ihrem jüngsten Roman "Das Eigentliche" zu lesen, der sich mit den Aporien und Abgründen unseres Umgangs mit den Naziverbrechen auseinandersetzt. Der Roman berührt eine seit Jahren und Jahrzehnten andauernde, mitunter hitzig geführte Debatte, in die sich Hanika mit satirischer Schärfe, aber ohne polemischen Überschwang und vor allem über den Umweg der Fiktion einbringt. Weil die Schriftstellerin eine rauchen wollte, fand das Gespräch auf der zugigen Freitreppe der Hauptbücherei statt.
Falter: Was ist Ihre liebste Todsünde?
Iris Hanika: Ich will doch keine Todsünde begehen.
Ja, eh. Aber
Hanika:
die Wollust.
Unser aller liebste Todsünde.
Hanika: Gefolgt von der Völlerei.
Wie kamen Sie auf Akedia, die Trägheit des Herzens, die die spannendste, weil undurchsichtigste Todsünde ist?
Hanika: Durch einen glücklichen Zufall habe ich das Buch von Roland Barthes gefunden, in dem er die erklärt – was meine Verehrung für Barthes ins Unermessliche gesteigert hat.
Ihrem Roman ist eine Textzeile von Leonard Cohen als Motto vorangestellt: "We are ugly, but we have the music." Was ist damit gemeint?
Hanika: Wir sind zwar hässlich, aber die ganze Welt ist elektrifiziert davon, was wir für tolle Sachen machen können. Man kann auf die Deutschen immer mit einem Nazivergleich einhauen
aber sie hatten immerhin Brahms und Beethoven!
Hanika: (Lacht.) Beethoven war Rheinländer, bitte! Nein, ich meine nicht die konkrete Musik, sondern den Umstand, dass man aus dem Hässlichen was Schönes machen kann.
Der Begriff des "Eigentlichen", der im Roman wiederholt vorkommt, aber mit unterschiedlichen Bedeutungen gefüllt wird, ist doch fragwürdig – nämlich dort, wo er das "Uneigentliche" entwertet.
Hanika: Es hört sich nach Koketterie an, aber ich bin nicht so gebildet. Wenn Sie jetzt also ins Philosophische gelangen wollen, kann ich nicht damit dienen. Vielleicht haben Sie sich aber vom Titel auch auf eine falsche Fährte locken lassen.
Sie verstehen ihn völlig unironisch?
Hanika: Nicht ganz. Denn es kommen natürlich viele "Eigentliche" vor, sodass es das eine Eigentliche wohl gar nicht geben kann. Und trotzdem hat jeder sein Eigentliches.
Warum haben Sie keinen Essay geschrieben?
Hanika: In einem Essay muss man sagen, wie's ist, und das mache ich sehr ungern – Meinungen äußern. Obwohl ich schon etwas schreiben wollte, von dem ich dachte: Das müsste mal gesagt werden.
Und das, was mal gesagt werden müsste, lautet: Man kann nicht ewig von Auschwitz reden und damit auch nicht wirklich leben
?
Hanika: Man kann es nicht aushalten, man kann aber auch nicht aufhören, davon zu reden.
Geht es Ihnen eher um Selbsttherapie oder um Tabubruch?
Hanika: Ich finde nicht, dass ich ein Tabu gebrochen habe, und Schreiben als Therapie funktioniert nicht.
Aber Sie wollten das Thema abhaken?
Hanika: "Abgehakt" klingt so läppisch, und es ist kein läppisches Thema. Ich beschäftige mich damit seit 25 Jahren und habe schon öfter darüber geschrieben, aber das, was ich eigentlich schreiben wollte, bin ich erst jetzt losgeworden. Insofern rundet sich vielleicht etwas.
Beschäftigen Sie sich weiterhin damit?
Hanika: Jetzt gerade nicht. Ich habe alle meine Ordner, auf denen "Gedenken" stand, geleert und weggeworfen.
Ist Auschwitz eine Ersatzreligion?
Hanika: Für manche Leute schon.
War es ein Fehler, dieses Thema quasi zu sakralisieren?
Hanika: Nein, das sind Dinge, die der Mensch in seiner Hilflosigkeit tut – weil doch so viel Böses passiert und man's halt wiedergutmachen möchte. Ich will das ja auch nicht anprangern.
Die Szene in der Kirche ist schon mit einem bösen Blick geschrieben. Und die Kirche gibt's auch wirklich, oder?
Hanika: Ja, das ist die Sühne-Christi- Kirche in Charlottenburg-Nord. Eigentlich wollte ich eine Reportage
über die schreiben, und die Reste
davon haben Eingang in das Buch gefunden.
Es wird dort unter dem Titel des Gedenkens ein Unheilszusammenhang etabliert, der von Kain über Golgatha bis Auschwitz und Hiroshima reicht.
Hanika: Ja, und was mich daran ärgert, ist, dass das sofort in die christliche Religion eingeordnet wird. Und das Einordnen hilft nicht! Ich fände es besser, wenn man diese Dinge zur Kenntnis nimmt und erst mal nix sagt. Wenn Einsatzgruppen die Dorfbevölkerung in eine Scheune treiben und die anzünden, kann man sich das nicht erklären.
Die Menschen, die bei Ihnen die Kirche besuchen, sind alles arme und wenig attraktive Figuren.
Hanika: Ja, aber es sind auch alles Leute, die in ein Orgelkonzert gehen, weil sie sich mit ihrem eigenen Unglück nicht beschäftigen wollen.
Lässt sich das von Besuchern von Orgelkonzerten generell behaupten?
Hanika: Schon möglich, ich war jedenfalls öfters bei Orgelkonzerten.
Ihr Buch ist insgesamt aber eher melancholisch als satirisch, oder?
Hanika: Ja, leider. Man könnte natürlich ein lustiges Buch übers Shoah-Business schreiben, das müsste dann aber zynisch sein. Und ich sehe zwar einen guten Grund, sich darüber lustig zu machen, aber zugleich finde ich es nicht richtig, mich über die Hilflosigkeit der Leute lustig zu machen: Die sind ja keine schlechten Menschen, die können bloß nicht anders.
Wobei der Verdacht im Raum steht, dass sie mit einem schweren Thema und dem Elend der Welt etwas maskieren, was viel persönlicher ist.
Hanika: Das kann man manchen Menschen doch regelrecht ansehen: Irgendetwas bereitet ihnen Unglück, sie sind aber nicht in der Lage, es zu bearbeiten, und verschieben es auf etwas anderes. Das trifft man in politischen Randgruppen sehr oft.
Die leben sogar davon.
Hanika: Ja. Das ist eigentlich ziemlich traurig.
In Ihrem Roman gibt es eine wunderbare Passage über all die Nazifilme, mit denen man in den Kinos behelligt wird. "Inglourious Basterds" gehört nicht diesem "seriösen" Genre an. Durch ihn sind die Nazis nun wohl der völligen Ästhetisierung anheimgegeben?
Hanika: Ich bin Tarantino unendlich dankbar dafür, dass er diesen Film gemacht hat, weil er zeigt, dass das alles Fiktion ist; dass wir unsere Ideen und Fantasien haben – und weiter nix.
Sie haben ihn wirklich gemocht?
Hanika: Ich habe mich monatelang darauf gefreut und ihn sehr gerne gesehen: "It's a bingo!"
Aber ist er nicht einfach infantil? In der Fiktion lassen wir jetzt mal die Juden zurückschlagen und Hitler erschießen.
Hanika: So meine ich das nicht, sondern ich meine, dass das, wie die Dinge, die vor 70 Jahren passiert sind, heute dargestellt werden, eine Fiktion ist – was übrigens auch für den Dokumentarfilm gilt.
Die Historikerin, die mit Ihnen nach der Lesung ein Gespräch führen wird, Heidemarie Uhl, schreibt, dass wir heute, wo die Generation der Zeitzeugen langsam ausstirbt, am "Übergang vom kommunikativen zum kulturell geformten Gedächtnis" lebten.
Hanika: Das ist eben der Punkt: dass "Inglourious Basterds" in einem Moment erscheint, in dem die Zeitzeugen verschwinden – und vielleicht verhindert, dass weiterhin Filme gedreht werden, die so tun, als würden sie die Wirklichkeit zeigen.
Glauben Sie?
Hanika: Wahrscheinlich nicht.
Shoah-Business und Empathie-Ermüdung
Klaus Nüchtern in FALTER 16/2010 vom 21.04.2010 (S. 21)
Iris Hanika, 1962 in Würzburg geboren, macht es mal andersrum: Wo österreichische Autoren meist zu deutschen Verlagen streben, ist sie von Suhrkamp zu Droschl gewechselt und wurde mit "Treffen sich zwei" prompt für den Deutschen Buchpreis 2008 nominiert. Nicht auszuschließen, dass ihr das bald wieder passiert, denn so mutige, witzige, kluge und anrührende Romane wie "Das Eigentliche" einer ist, gibt's nicht viele.
Hanikas Unterfangen ist heikel, denn ihr Thema "ist das Shoah-Business" zu dem dem Protagonisten Hans Frambach dessen Arbeit im "Institut für Vergangenheitsbewirtschaftung" geworden ist: "Ich habe immer gedacht, es sei meine Pflicht, diese Arbeit zu tun, aber mittlerweile komme ich mir mit meinem Pflichtbewusstsein wie ein KZ-Wächter vor, nur dass heute die KZ-Wächter dafür sind, die Erinnerung wachzuhalten."
Das erinnert in seiner provokativen Power an Martin Walsers berüchtigte Pauluskirchenrede – sollte allerdings nicht als in Figurenrede gekleideter Revisionismus der Autorin missverstanden werden. Auch wenn man die Auslassungen zur Naziversessenheit des zeitgenössischen Kinos, die schon in der bloßen Beschreibung zur Polemik tendieren, wohl als deren eigene Meinung identifizieren kann, ist Hanikas Umweg über ihren Helden entscheidend: Hier leidet einer nicht nur an Empathie-Ermüdung, sondern unter jener existenziellen Freudlosigkeit, die unter dem Begriff "Acedia" theologische Karriere gemacht hat – gilt die "Trägheit des Herzens" doch als eine der sieben Todsünden.
"Das Eigentliche", das immer wieder aufgerufen wird, ist ein gefährliches Terrain, sobald es mit dem Unpersönlichsten und Allgemeinsten identifiziert wird: Als läge es im Wesen eines Menschen, ermordet zu werden oder als realisiere sich das Menschsein einer Frau just darin, "die Ficknudel eines Pantoffelhelden zu sein", wie es Graziela in einem Moment der Selbsterkenntnis bissig formuliert – um mit dem anschließenden herzlichen Lachen sogar ihren zwangsneurotisch-zwideren Freund Frambach anzustecken. Dass ein derart facettenreiches Buch mit einem so uninspirierten und billigen Umschlag versehen wurde, tut allerdings echt weh.