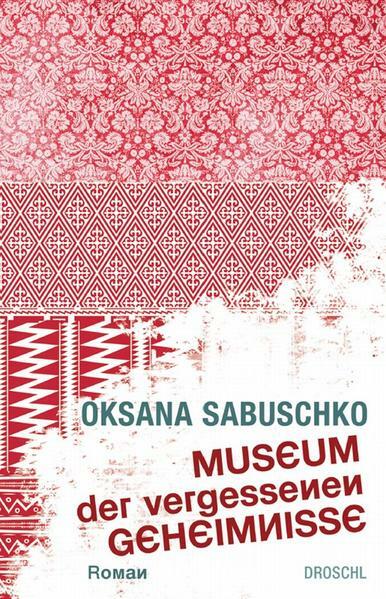Mysterien einer Frauentasche
Erich Klein in FALTER 46/2010 vom 17.11.2010 (S. 31)
Oksana Sabuschko lässt ihren Romanfiguren die Geschichte der Ukraine durch die Köpfe spuken
Mit der orangenen Revolution trat 2004 ein halbes Dutzend ukrainischer Autorinnen und Autoren auf den Plan, von denen der Westen noch nie gehört hatte. Die "Feldstudien über ukrainischen Sex" von Oksana Sabuschko
(Jg. 1960) kamen da gerade recht, auch wenn das Buch schon zehn Jahre alt war. Die Philosophin, Essayistin und Lyrikerin schrieb darin über alles Mögliche – spät-
sowjetische Depression, Schreiben, Selbstmord, nationale Identität. Sex kam eher wenig vor, aber der Werbegag funktionierte.
Vor großen ukrainischen Fragen hatte Sabuschko, die während der 90er-Jahre hauptsächlich in den USA lebte, keine Angst: Essayistisch zerpflückte sie ein Nationalheiligtum, den "Mythos Taras Schewtschenko" (1996), in jüngerer Zeit folgten die bislang unübersetzten "Texte zur ukrainischen Revolution" (2005) und "Notre Dame d'Ukraine" (2007). Die Paradefeministin und ukrainische Pen-Präsidentin rief auch Neider auf den Plan – ihr Wiki-Eintrag wurde kürzlich mit dem despektierlichen Hinweis "Mitglied der
KPdSU und des Sowjetischen Schriftstellerverbandes" versehen.
"Museum der vergessenen Geheimnisse" ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Der 760-Seiten-Roman will Geschichtsunterricht, moralischer Traktat, Thriller und Lexikon aller möglichen Ausdrücke des Ukrainischen (samt Slang) sein; und diesmal geht es tatsächlich auch um Sex.
Motto ist eine Aufschrift aus einer Zelle des Lemberger KGB-Gefängnisses von 1952: "Willst du wissen, was mit uns ist? Warte auf uns." Im Roman wird das später so erklärt: "Woher haben wir die ständige Überheblichkeit gegenüber der Vergangenheit, die unüberwindbare dumpfe Überzeugung, dass wir Jetzige entschieden klüger als die Damaligen seien – doch nur deshalb, weil wir ihre Zukunft kennen." Und die war düster, tragisch und vergeblich.
Daryna, Leiterin eines staatlichen Fernsehprogramms in Kiew, wird Adrian lieben – wenn man das bei einer Erzählung, deren Figuren über keine besonders deutlichen Grenzen verfügen, so eindeutig sagen kann. Ein vergilbtes Foto setzt Erinnerungen (der Erzählerin?) an die Zeit vor dem Farbfernseher und an Sowjettage in Gang; an die ersten, von kanadischen Verwandten geschickten Levi's-Jeans, vermischt mit dem obskuren Duft von Krasnaja Moskwa, dem berühmtesten aller sowjetischen Parfüms. Der erste Sex ist monoton wie die Musik von Philip Glass. War so viel Westlertum vonnöten?
Auf dem Foto ist die Partisanin Helzja zu sehen, die mit "aristokratisch ungezwungener Selbstverständlichkeit im Wald umgeben von vier Männern mit Maschinenpistole posierte". Während sich Daryna in deren Anblick verliert, macht sich ihr Ex Artjom an ihrem Rockschlitz zu schaffen – schon nestelt er am Slip herum: "Aber ich konnte das Foto nicht einfach bei Artjom lassen. Es war meines, oder besser gesagt, es wurde zu meinem. Aber nicht etwa, weil ich mich über diesem Foto widerstandslos, gar zu willig ficken ließ, sondern eher im Gegenteil: widerstandslos, weil ein fremder Wille von mir Besitz ergriffen hatte."
Die Geheimnisse der Ukraine (mit ein bisschen Helmut-Newton-Kitsch) im Staatsarchiv haben ihren Gegenpol in der ironisch gebrochenen Geschichte von Darynas Künstlerfreundin Wladislawa, Spezialistin "für alle weiblichen Geheimnisse", wozu auch vergrabene Ikonen und Kinderspiele in der Sandkiste gehören.
Ihre bekannteste Arbeit trägt den Titel "Der Inhalt einer Frauentasche aufgefunden am Unfallort". Auf mysteriöse Weise wird Wlada bei einem Autounfall in der Nähe Kiews umkommen – an einer "unreinen" Stelle, wo in den 1990er-Jahren auch einige Politiker verunglücken.
Was auf den nächsten 600 Seiten passiert, ist nicht mehr ganz einfach wiederzugeben. Daryna begegnet Adrian, dem Enkel der Partisanin Helzja/Olena; über endlos wuchernde essayistische Abschweifungen, unzählige Erzählstränge und Gespräche über die tragische Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert hinweg "vereinigen" sich die beiden. Die Kollaboration mit den Nazis und der Kampf gegen die Sowjets spielen als Traumsequenzen in die Gegenwart der Figuren hinein. Noch immer lauten die zentralen Fragen: Wer war dabei? Wer war dagegen?
Oksana Sabuschkos "Museum der vergessenen Geheimnisse" deutet vieles – etwa die Hungersnot der 1930er-Jahre – nur an; durch die Köpfe ihrer Figuren spuken Weltverschwörungen und Konspirationen aller Art. Erst im Schlussmonolog des Archivars Pawlo Iwanyowitsch löst Sabuschko ein, was man lange Zeit schmerzlich vermisste: Spannung, wie sie bei der Suche nach großen historischen Wahrheiten angebracht ist. Überraschendes, sarkastisches Ergebnis: War ein KGB-Mann irgendwie der Retter?
Ob es sich um ein Jahrhundertbuch handelt, sei dahingestellt. Aber die Wahrheit ist nie einfach zu haben, und die jüngsten Entwicklungen der Ukraine machen das Buch ohnedies zur Pflichtlektüre.