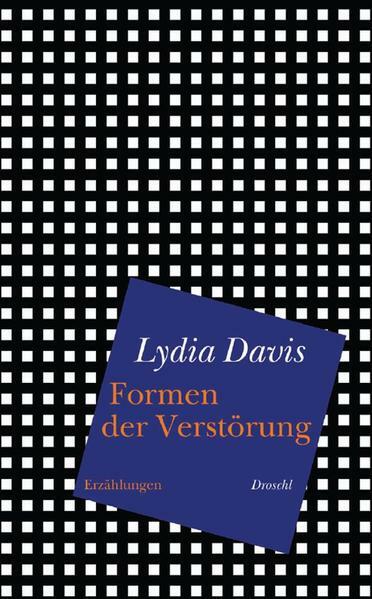Kafka kocht, und Nietszche schreibt man anders
Klaus Nüchtern in FALTER 11/2012 vom 14.03.2012 (S. 25)
Mit "Formen der Verstörung" legt Lydia Davis eine Reihe extrem kurzer, vor allem aber ziemlich witziger Erzählungen vor
Man könne eine Erzählung von Lydia Davis, so meinte ein Kritiker einmal, auch während einer roten Ameplphase im Auto lesen. Das ist richtig. Man kann – auch wenn dies aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht zu empfehlen ist – einzelne Geschichten sogar während des Autofahrens am Highway lesen. Die kürzesten, der in dem vor fünf Jahren im Original ("Varieties of Disturbance", 2007) erschienen Erzählungen sind bloß einen Satz lang und kaum länger als ihr Titel. Die lustigste von ihnen heißt "Mutters Reaktion auf meine Reisepläne" und geht so: "Gainsville! Zu schade, dass dein Cousin tot ist!"
Solche Super-Short-Storys tendieren naturgemäß zum Aphorismus, wobei aber nicht immer ganz klar ist, worin die Pointe besteht. "Armer Vater. Es tut mir leid, dass ich mich über dich lustig gemacht habe. Und jetzt schreibe ich Nietszche auch noch falsch."
Was geht hier eigentlich vor? Ein Vater-Tochter-Drama allem Anschein nach. Aber können wir dem Bedauern der Tochter trauen? Oder liegt hier ein klassischer performativer Selbstwiderspruch vor, hinter dem sich eine ausgemachte Hinterfotzigkeit verbirgt? Vielleicht ist der Vater ja ein rechthaberischer Nietzsche-Spezialist, der seinerzeit stark unter der Rechtschreibschwäche der Tochter gelitten hat. Und die rächt sich jetzt dafür, indem sie Nietzsche "auch noch" falsch schreibt: In der Überschrift und dann "auch noch" in einem Satz, der den Vorsatz zum Orthografieverstoß verrät.
Lydia Davis ist das, was man "a writer's writer" nennt. Kollegen wie Jonathan Franzen oder Jeffrey Eugenides, die von ihren Romanen die ein oder andere Zehnerpotenz mehr verkaufen als Davis von ihren Büchern, preisen die Prosa der 1947 in Massachusetts geborenen, gerne mit Kafka und Beckett verglichenen Autorin, die auch einmal mit Paul Auster verheiratet war, bislang einen Roman sowie zahlreiche Erzählbände vorgelegt und darüber hinaus auch noch Flaubert und Proust übersetzt hat.
Davis kann knapp erzählen, hat mit der Short Story in der Tradition von Raymond Carver und Gordon Lish aber gar nicht so viel zu tun. Manche ihrer Erzählungen sind auch ganz schön ausufernd und an die 50 Seiten lang. Weniger um Lakonie als um Klarheit ist es Davis zu tun. Ihre Geschichten, die oft aus ganz alltäglichen Situationen erwachsen, folgen meist einer leicht zu durchschauenden Systematik, tendieren zur Aufzählung und zum Positivismus, machen sich aber mitunter auch darüber lustig.
Und wenn Kafka ein Abendessen kochen muss, so nicht ohne die erwartbaren Selbstzweifel: "Ich bat sie, komm doch bitte nicht zum Essen, aber dann sagte ich, sie solle doch bitte nicht auf mich hören, sondern trotzdem kommen."