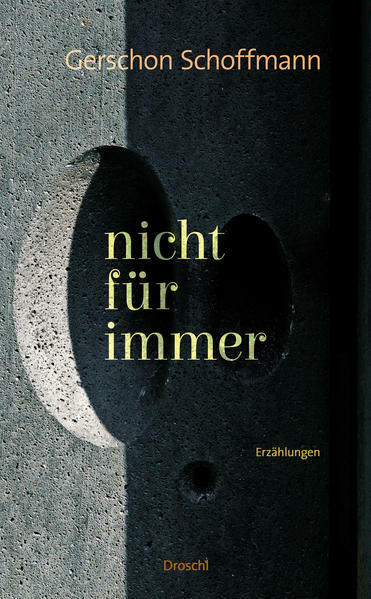Down and out in Wien und Wetzelsdorf
Thomas Leitner in FALTER 11/2017 vom 15.03.2017 (S. 15)
Exil und Emigration: Gerschon Schoffmann und Mosche Ya’akov Ben-Gavriêl sind wiederzuentdecken
Zwei Entdeckungen – ein im deutschen Sprachraum bislang völlig unbemerkter Autor und ein einst durchaus bekannter, heute vergessener – geben eine Ahnung von dem in Kriegs- und Zwischenkriegszeit verschütteten Reichtum mitteleuropäischer jüdischer Literatur. Gerschon Schoffmann, 1880 im zaristischen, heute weißrussischen Orscha geboren, desertierte vor seinem Einsatz im russisch-japanischen Krieg 1904 ins österreichische Galizien, lebte in Lemberg und überlebte den Ersten Weltkrieg als russischer Staatsbürger am Wiener Alsergrund. Nach seiner Heirat mit einer katholischen Proletarierin zog er nach Wetzelsdorf bei Graz, auch hier unstet und isoliert. 1938 gelang dem Ehepaar mit den beiden Kindern gerade noch die Ausreise nach Palästina.
Obwohl seine ersten Sprachen wohl Jiddisch und Russisch waren und er die russische Literatur bewunderte, schrieb Schoffmann von Anfang an im damals als Literatursprache noch jungen Hebräisch. Nun wurde er erstmals ins Deutsche übersetzt. Unter dem Titel „Nicht für immer“ liegt eine umfangreiche Auswahl von Prosatexten vor, die mit ganz wenigen Ausnahmen in den Jahren des Aufenthalts in Österreich entstanden sind. Meist handelt es sich dabei um kurze, eine Seite nicht überschreitende Skizzen, die an die Miniaturen von Schoffmanns Vorbild Peter Altenberg anknüpfen. Einige längere Erzählungen erinnern atmosphärisch an ein anderes Idol Schoffmanns, nämlich Anton Tschechow.
Doch nicht die stilistische Meisterschaft, mit der er diesen großen Vorbildern nacheifert (die er übrigens beide ins Hebräische übersetzt hat), machen die Faszination aus, die von Schoffmanns Prosa ausgeht, sondern die unverwechselbare Stimme eines überall Fremden, der die mitteleuropäische Welt von Minsk bis Graz durchstreift. Die religiös bestimmte Atmosphäre zwischen der jüdischen Aufklärung Haskala und dem chassidischen Hang zur Mystik beherrscht die Erinnerung an die Jugend im Schtetl. Auch die Konfrontation mit dem Drill und den Demütigungen der Militärzeit bleiben fest im Gedächtnis verankert.
Das alles hallt immer noch nach in Schoffmanns Wiener Zeit, als die Auflösung aller Ordnung, Antisemitismus und Wohnungsnot klirrende Kälte in stickige Kaffeehäuser weht. Der Umstand, dass die Protagonisten in den Texten der 20er-Jahre in einem Familienverband stehen, mildert die Isolation kaum: Nur ansatzweise führen sie ein harmonisches Eheleben, die enge dörfliche Gemeinschaft schließt sie noch mehr aus als die Großstadt. In den Kurztexten ebenso wie in den Prosasuiten der längeren Erzählungen verdichtet sich die Unheimlichkeit der „flüchtigen“ Existenz des Autors. Autobiografisches und Fiktionales verschmelzen. Bedrängt und verfolgt durch materielle Not, familiäre und soziale Gewalt, stellt die geistige Heimatlosigkeit für den meist nur anonym als „er“ bezeichneten Protagonisten eine Konstante dar. Am beklemmendsten sind jene Szenen dumpfer ländlicher Gewalt, in denen Stimmungen anklingen, denen man so kalt und bedrohlich erst wieder in den frühen Arbeiten von Thomas Bernhard begegnet.
Dazu gesellt sich eine Erotomanie, die Schoffmann mit Peter Altenberg teilt (auch hier: sehr junge Mädchen), die er aber im Gegensatz zu diesem als schuldhaft und beschwerend erlebt. Humor oder Ironie, die das lindern könnten, fehlen gänzlich. Ruth Achlama gelingt es großartig, den Ton einer allgegenwärtigen Fremdheit in ihrer Übersetzung durchklingen zu lassen – er ist im besten Sinne „eigen“. Und die „biografische Annäherung“ des Herausgebers Gerald Lamprecht erweist sich bei der Erschließung der jüdischen Migrantenliteratur als äußerst hilfreich.
Einer anderen Facette dieses Themenkomplexes nimmt sich der Arco-Verlag in Zusammenarbeit mit akademischen Instituten in Basel, Hamburg und Jerusalem an. Die Reihe „Europa in Israel“ macht unveröffentlichte oder einst kaum rezipierte Texte deutschsprachiger Autoren in Israel einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Sie startet mit dem „Tatsachenroman“ „Jerusalem wird verkauft“ von Mosche Ya’akov Ben-Gavriêl, der 1891 als Eugen Hoeflich in Wien auf die Welt kam. In den 50er-Jahren war der längst nach Israel ausgewanderte, aber immer noch auf Deutsch schreibende Ben-Gavriêl als Autor von Kriminalromanen und Satiren à la Kishon erfolgreich. „Das Haus in der Karpfengasse“, ein literarisch gewichtiges Werk, das in Prag während der deutschen Besatzung spielt, fand große Beachtung.
Das persönlichste Buch des Autors aber, ein zum Roman umgearbeitetes Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg, wurde nur in hebräischer Übersetzung publiziert (1946). Aus einer assimilierten Familie stammend, erlebt Ben-Gavriêl den Weltkrieg zunächst an der Ostfront und wird schwer verletzt. Danach kommt er an den wohl seltsamsten Kriegsschauplatz und dient als Versorgungsoffizier am österreichischen Militärhospiz im damals noch türkisch beherrschten Jerusalem. Der Aufenthalt währt nicht lange, man beruft ihn schon vor dem allgemeinen Abzug 1917 zurück – der Obrigkeit missfiel sein allzu reges Interesse an der lokalen Bevölkerung.
Das Tagebuch zeugt von der Aufgeschlossenheit gegenüber den Problemen von Juden und Arabern, die jene Kriegsjahre als Spielball der Großmächte in Elend erlebten. Schon der Zwischenaufenthalt in Konstantinopel, die Bahnreise durch die kriegserschütterte Türkei konfrontieren den Autor mit Schiebereien und Spekulationen unter den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen. Die Massaker an den Armeniern bleiben weder unbemerkt noch unerwähnt. Und Jerusalem schließlich ist das Zentrum der Korruption, der Eifersüchteleien zwischen den Alliierten und der Willkür gegenüber der Zivilbevölkerung. Einzig die Österreicher bleiben gelassene Beobachter der apokalyptischen Anarchie und benehmen sich wie ungezogene Kurgäste.
Auch in diesem Laboratorium sind letzte Tage der Menschheit angebrochen, manche Schwejk’sche Figur taucht da auf. Die Schilderung des Besuches eines veritablen Erzherzogs, der übrigens vom Orientalisten Alois Musil begleitet wird (der ebenfalls sein Fett abbekommt), erreicht eine Schärfe, die dem Sarkasmus von Kraus und Hašeks burleskem Ton nicht nachsteht.
Im Zentrum des Interesses stehen für Ben-Gavriêl freilich die Lebensbedingungen der jüdischen Bevölkerung, die hier schon ab dem frühen 19. Jahrhundert, vermehrt dann ab 1882 in der Alija, der Fluchtbewegung vor osteuropäischen Pogromen, Fuß gefasst hatte. Die ausgesprochen eigenartige Vision, die er für die Neuankömmlinge entwirft, teilten wohl schon damals nur die wenigsten: Merkwürdig kulturpessimistisch sieht dieser „Panasiatismus“ die Verbrüderung der Juden mit den Arabern, ja mit allen unterdrückten Völkern Asiens und die Verabschiedung von der fortschrittsgläubigen westlichen Zivilisation vor. Vielleicht war auch dieser irrational gefärbte Antikolonialismus der Grund für die Umwandlung des Tagebuchs in einen Roman. Die Aufzeichnungen werden nämlich einem nichtjüdischen Erzähler zugeschrieben, die programmatischen Passagen dem einzigen ernstzunehmenden Gesprächspartner, einem jüdischen Offizierskollegen, in den Mund gelegt. Doch weder dieses ein wenig windschiefe narrative Gerüst noch die nicht recht nachvollziehbare Utopie mindern die Faszination des Buches und das Vergnügen an dessen schwarzem Humor sowie die Bewunderung für die einfühlsame und klarsichtige Beobachtungsgabe des Autors.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: