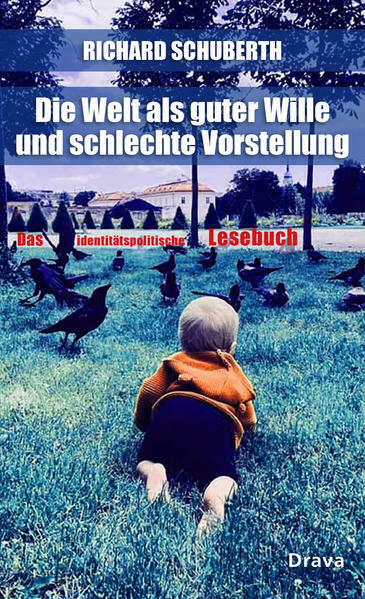Olja Alvir in FALTER 26/2022 vom 29.06.2022 (S. 30)
Als sogenannter "alter weißer Mann"
liefert Richard Schuberth ausgerechnet ein Kompendium zur sogenannten "Identitätspolitik". Sich des Dilemmas bewusst, fragt er: "Was rechtfertigte den Senf, den ich in den ohnehin randvollen Bottich des Diskurses abzusondern hatte?" Sein frecher Witz und die Hingabe an die schlagendste Formulierung mögen auch Skeptische überzeugen. Schuberth schafft es, gleichzeitig Kritik an der Identitätspolitik zu formulieren und sie gegen den rechtspopulistischen Mainstream zu verteidigen. Damit stellt dieses Lesebuch keine Anleitung zum Verrat an emanzipatorischen Bewegungen dar. Es ist vielmehr eine Rückschau auf das Œuvre eines geübten Ideologiekritikers und scharfen Senfdazugebers voll unbequemer, aber umso erhellenderer Gedanken. Ein Buch, das allen eins auf die Nase gibt, auch dem Autor selbst.