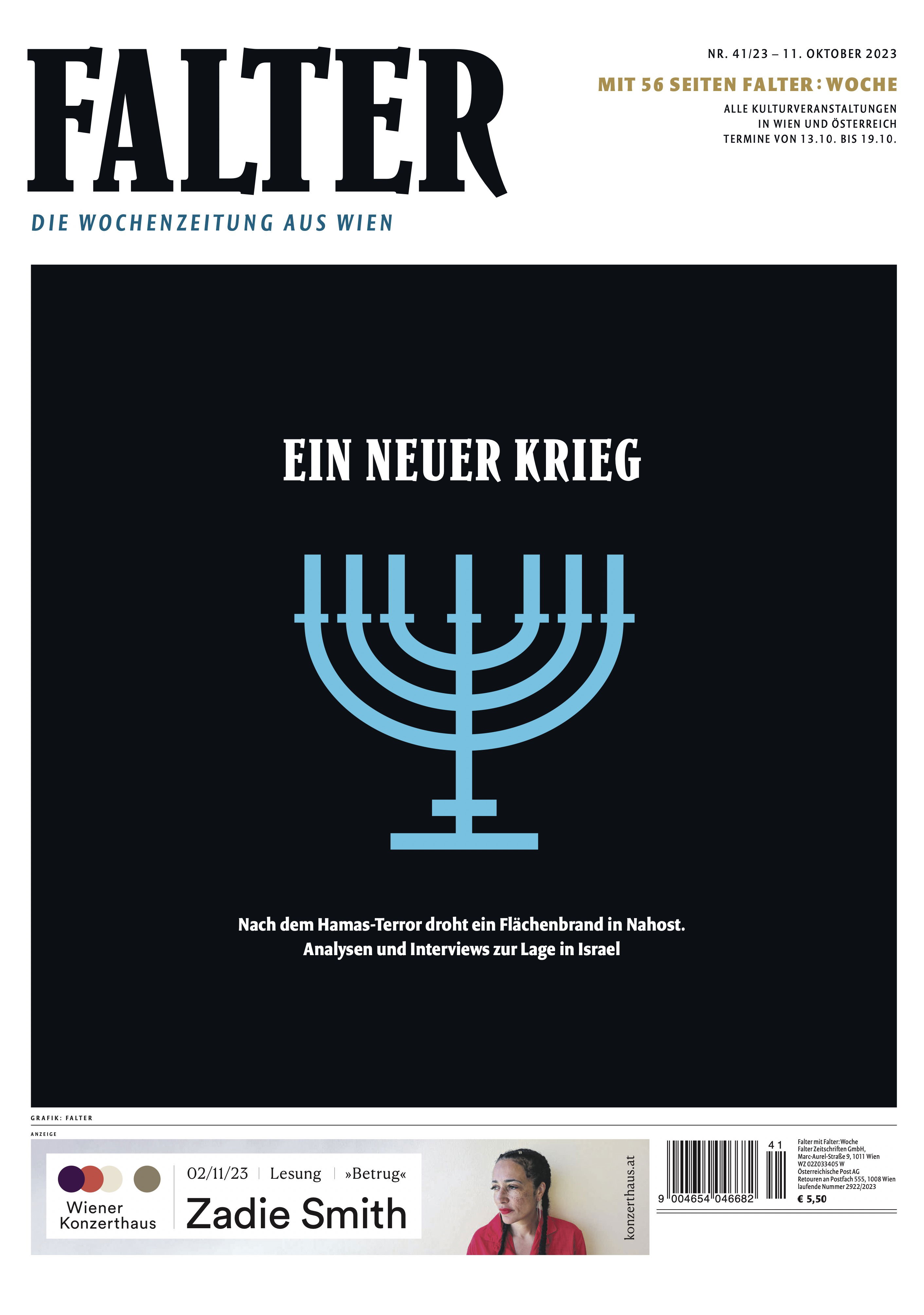
Wo das Wiener Wasser fließt
Katharina Kropshofer in Falter 41/2023 vom 2023-10-11 (S. 35)
An seinem Ursprung schaut das Wiener Wasser friedvoll aus, fast kümmerlich. Was zwei Millionen Wiener jeden Tag versorgt, beginnt mit einem leisen Plätschern. Doch hier in der Franz-Josefs-Quelle, am Fuße des Schneebergs, entspringt das vielleicht beste Großstadtwasser der Welt.
Zuvor muss es sich aber den langen Weg durch das Gestein bis zur Quelle bahnen: "Den Karst kann man sich vorstellen wie an Emmentalerkas, wo das Wasser durchrinnt, mit ana Glasplattn drunter", sagt Hans Tobler. Seit 30 Jahren ist er Hüter der Quellen, Leiter der ersten Wiener Hochquellenleitung. Und führt hinein in den Stollen.
Bis zu 10.000 Liter pro Sekunde fließen aus insgesamt 70 steirischen und niederösterreichischen Quellen Richtung Wien. Bis zu 3000 Kilometer nimmt es durch Felsspalten und Rohre bis zu den Eintrittspforten der Stadt. Im Wasserspeicher Rosenhügel und in 28 weiteren Behältern sammeln sich Milliarden Liter Trinkwasser, die später in weiteren 800 Kilometern Rohrstrecke in die 940.000 Haushalte Wiens fließen.
Und zwar im freien Fall, quasi ohne zusätzlichen Energieaufwand. Seit nun genau 150 Jahren. "Es war eine fantastische G'schicht. Um nicht zu sagen irrsinnige G'schicht", sagt Tobler über die Gründertage dieser Leitung. Das Unglaubliche ist, dass es überhaupt so weit kommen konnte.
1873 Wien war schon vor 150 Jahren eine Stadt der Widersprüche: einerseits das Geklapper der Pferdehufe, der Gestank von Essensresten und anderem Unrat. Doch dazwischen winkte schon die Moderne: die ersten Telegrafenmasten, um den ganzen Ring Baustellen, und im Prater wurde Wien mit der sich auf 2.330.631 Quadratmetern ausdehnenden Weltausstellung zum Mittelpunkt der Welt.
Wenn die halbe Million Einwohner Glück hatten, konnten sie ihr Trinkwasser damals aus dem Hausbrunnen pumpen. Eine funktionstüchtige Kanalisation gab es nur in der heutigen Innenstadt. Zeitungen beschrieben das Wiener Wasser als "lauwarm und trübe","nicht ohne einen gewissen Ekel" zu trinken, wie der Stadthistoriker Peter Payer schreibt. Gemeinsam mit dem Fotografen Johannes Hloch hat er in Archiven gewühlt und ein Buch zum Jubiläum der Hochquellenleitung herausgebracht.
Die Vorzeige-Metropolen Paris (wo Ingenieure Gebirgswasser in die Stadt zu leiten begannen) und London (wo sie der Themse Wasser entnehmen wollten) ersehnten sich damals besseres Trinkwasser. Es hatte sich eine neue Hygienebewegung formiert, die Menschen wussten nun über Bakterien und ihre Wirkung im menschlichen Körper Bescheid - und glaubten an technologischen Fortschritt als Lösung.
Rechtzeitig vor der Weltausstellung hat auch der Wiener Gemeinderat unter dem liberalen Bürgermeister Andreas Zelinka 1862 eine Wasserversorgungskommission eingerichtet und einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben. Das Naheliegendste? Wasser aus der Donau zu entnehmen. Kein Einziger der Einreicher erwog es, Wasser aus Gebirgsquellen heranzuschaffen. Zu teuer, zu gewaltig erschien die Idee.
Wären da nicht zwei Utopisten im Gemeinderat gesessen. 1863 ernannten die Stadtpolitiker den späteren Bürgermeister Cajetan Felder -anerkannter Schmetterlingsexperte und Mann der Forschung - zum Obmann der Wasserversorgungskommission. Er war das verständnisvolle Visavis für Eduard Sueß.
Wer den Geologen Sueß beschreiben will, wird um das Wort Visionär nicht herumkommen. Er wusste, dass schon die Römer Quellwasser aus dem Süden in ihr Legionslager Vindobona brachten. Und war überzeugt: Auch heute müsse Wien die nahen Berge und das qualitativ überlegene Quellwasser nutzen. Das würde auch Dampfmaschinen zum Säubern des Flusswassers sparen. "Geologen denken einfach in größeren Zeiträumen", sagt der Stadthistoriker Peter Payer.
Der Gemeinderat teilte die Begeisterung nicht. Das Vorhaben sollte 17 Millionen Gulden - heute wären das 221 Millionen Euro - kosten, das teuerste Infrastrukturprojekt jener Ära. Zeitungen druckten Schmähschriften, im Wirtshaus zerriss man sich die Mäuler, der scheidende Bürgermeister Zelinka soll "Sueß, Sie sind ein Narr!" gerufen haben. "Sie wollen Wasser aus dem Gebirge herleiten, und die Donau fließt vor unserer Haustür!"
Den Schlüsselmoment erzählen einander Historiker bis heute: Eduard Sueß, Cajetan Felder und Regierungsrat Heinrich von Fellner reisten im August 1864 für eine Besichtigung ins Höllental im Süden Niederösterreichs. Sie inspizierten das Flussbett der Schwarza und die Franz-Josefs-Quelle. Als sie auf dem Rückweg am Bahnhof in Leobersdorf umsteigen mussten, hätten sie einen Schwur abgelegt: Sie würden die Hochquellenleitung verwirklichen.
Drei Männer mit Überzeugungskraft, die Hygienebewegung und, laut dem heutigen Quellenchef Tobler, eine dritte Zutat brauchte es: "Wäre die Not in Wien nicht so groß gewesen, wäre es vielleicht anders gekommen." Cholera, Typhus, Pest: Die Seuchen gehörten zu den Großstädten wie der Rüschenrock zur Damenuniform. Allein zwischen 1831 und 1873 starben 18.000 Wiener und Wienerinnen an Cholera.
Also brachten ab 1870 Hubwagen Stahl, Ziegel und Dynamit in die Täler vor der Stadt. Acht Teams arbeiteten in drei Schichten rund um die Uhr. Die hohen Aquädukte und tiefen Stollen nahmen Gestalt an. Beamte überzeugten indes Gutsherren, benötigte Grundstücke zu verkaufen.
Am 24. Oktober 1873 war es dann endlich so weit: eine Wasserfontäne aus dem neuen Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz schoss in die Höhe. "Ein vieltausendstimmiger Ruf des Staunens füllte den weiten Raum", schrieb Eduard Sueß über "seine" Eröffnungsfeier. Nun reichte den Wienern ein Dreh an der Bassena im Hausgang, um Wasser zu bekommen. Zähneputzen galt als neuer Trend.
So reibungslos ging es aber nicht weiter. Die Karstquellen schütteten im Winter nicht so viel Wasser aus wie im Sommer, es wuchs nicht nur die Bevölkerung, sondern auch der Wasserbedarf jedes Einzelnen. Schon im ersten Winter wurde das Wasser knapp. Der Brunnen am Schwarzenbergplatz versiegte regelmäßig. Kritiker sprachen von der Leitung als riskantes Luxusprojekt.
Die Stadt aber baute unbeirrt neue Wasserbehälter, erschloss Quellen, schrieb sich 1883 in die Bauordnung, dass neue Häuser Wasseranschlüsse bekommen müssen. Die Typhusfälle gingen zurück, Cholera verschwand fast ganz. Und 1888 versorgte die Leitung schließlich 90 Prozent der Wiener Haushalte. Plötzlich war es ein Erfolg der ganzen Kommune: Ansichtskarten zeigten den kolossalen Bau, Firmen vermarkteten das Sodawasser mit mythischen Figuren.
Als es 1910 dann zwei Millionen Wiener gab, eröffnete schon die zweite Hochquellenleitung, diesmal mit Wasser aus dem Hochschwabgebiet. Bis heute justieren die Planer nach, erschließen neue Quellen, bauen das Netz innerhalb der Stadt aus. Und hier kommt Hans Tobler ins Spiel.
2023 Der Mann, der sein Leben als Work-Work-Balance beschreibt und Freunde zu Wasserverkostungen lädt, liest selbst im Urlaub noch Bücher über seine Berufung: Hydrologie, Klimawandel, Kraftwerkskunde. Und auch heute, an einem warmen Wochenende Ende September, findet Tobler keine Ruhe.
Wer zu ihm will, muss die Dörfer Gloggnitz, Payerbach und Reichenau passieren, und viele Schilder, die das Wasser für Wien bewerben. Monumental zerteilen die alten Aquädukte die Landschaft, bevor sich die Landesstraße zwischen steilen Felswänden emporwindet. Am Ende des Tals erinnert das Wiener Wasserleitungsmuseum an den Ursprung: 1865 schenkte der Kaiser der Stadt Wien die Kaiser-Franz-Josefs-Quelle. Für Hans Tobler bedeutet das Geschenk Alltag. Er und seine Mitarbeiter müssen die dreieinhalbtausend Sensoren warten, Tobler selbst Besucher durchs Wasserleitungsmuseum führen, die Elektriker, Techniker, Juristen und Maler einteilen.
Mehrmals täglich planen sie, wie viel Wasser aus welchen Quellen weitergeleitet wird: Steht ein warmes Wochenende an, an dem es die Leute aus der Stadt zieht? Oder lädt das Herbstwetter eher zum kuscheligen Teetrinken auf der Couch ein? Wien will schließlich bei jedem Wetter lückenlos versorgt sein. Im Durchschnitt mit 390 Millionen Litern pro Tag, an Hitzetagen verbrauchen Haushalte und Betriebe sogar bis zu 530 Millionen Liter.
"Wasserversorgung ist kein Zufall, es ist ein durchgestyltes Betriebskonzept", sagt Tobler. Vor allem aber ist die Lebensader für zwei Millionen Menschen ein Hochsicherheitsbetrieb. So "top secret" ist die Angelegenheit, dass Schaulustige (und Journalistinnen) die Wasserbehälter nicht einmal besichtigen dürfen. Auch Tobler hat keinen Schlüssel für den Speicher am Rosenhügel.
Würde eine Bombe eines der exponierten Aquädukte treffen, brächten seine Leute passende Rohre aus dem Geheimlager in Laxenburg, um die angeschnittenen Leitungen wieder zu verbinden. Bei einem Blackout würde das Wasser immer noch per Schwerkraft nach Wien gelangen. Lediglich die letzten Meter könnten schwierig werden, etwa hinauf zum Kahlenberg.
Wien hat für seine Wasserversorgung ganze Gegenden aufgekauft: 197 von 250 Quadratkilometern Quellgebiet sind im Besitz der Stadt, das Schutz-und Schongebiet gehört zum Sicherheitskonzept wie Pläne für den Krisenfall. Will ein Land-oder Forstwirt verkaufen, nutzt das die Stadt, um die Fläche zu erweitern und so mehr Kontrolle über die Bewirtschaftung zu haben.
Auf den Eigenflächen bedeutet das Forstwirtschaft, die Bediensteten entnehmen nur einzelne Stämme. Würden sie ganze Flächen kahlschlagen, könnte starker Regen den Boden auswaschen. Die paar Tiere, die auf den Weiden grasen, sind penibel dokumentiert. Selbst für zwei Hütten im Raxgebiet hat die Stadt eine eigene alpine Kanalanlage gebaut, damit die menschlichen Abfälle ja nicht gen Grundwasser fließen.
Würden doch einmal Verunreinigungen ins Quellwasser gelangen, wüsste man es binnen zwei Minuten: So oft senden Sensoren aus jeder Quelle Daten über den Wasserzustand. Zur Desinfektion rinnt das Wasser durch eine Edelstahlkammer, UV-Lampen senden Strahlen, das dringt in eventuell vorhandene Erreger ein, macht sie unschädlich.
Zweifellos fließt hier eines der besten Wasser der Welt, und das für eine Großstadt. Das sagt Regina Sommer, Leiterin der Abteilung Wasserhygiene an der Medizinischen Universität Wien. "Man muss nicht weit schauen, um andere Situationen zu finden." Selbst unsere Nachbarländer würden meist Oberflächenwasser aus Flüssen oder Seen entnehmen, viele Aufarbeitungsschritte machen das Wasser trinkbar.
Kein Wunder, dass Menschen seit jeher mit viel Emotion auf die Wiener Hochquellenleitung blicken. Neben Stolz ist das auch Neid. Noch 1996 wollte die damalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic (ÖVP) ihr Wasser schützen und erwog eine "Wassersteuer" für die Zufuhr ins Hochquellleitungsnetz. 2,5 Schilling pro Kubikmeter sollten die Wiener zahlen. Der "Wasserschilling" kam nie, die Spannungen dauern bis heute an. Im steirischen Quellort Wildalpen etwa sprechen Kenner von einer zweigeteilten Bevölkerung: jene, die vom Tourismus, vom Wildwasserrafting und Kajakfahren leben. Und jene, die für Wiener Wasser arbeiten und weiteren Fremdenverkehr inklusive möglicher Verunreinigungen verhindern möchten.
Rechtlich gesehen darf die Magistratsabteilung 31 (Wiener Wasser) 421 Liter Quellwasser pro Sekunde nutzen. Braucht sie mehr und schneidet sie anderen Betreibern etwa die Stromerzeugung ab, ist die Stadt Ausgleichszahlungen schuldig. Doch in Zeiten, in denen auch aus Österreich Bilder von ausgetrockneten Flussbetten und Fischen auf dem Trockenen kommen, drängt sich schon eine Frage auf: Wie lang kann das gut gehen? Wird uns die 150 Jahre alte Leitung denn ewig Dienst leisten?
2050 Wien hat nun 2,2 Millionen Einwohner, und die werden, so die Stadt, um 15 Prozent mehr Wasser verbrauchen. Bei häufiger Hitze werden sie vielleicht noch häufiger duschen, ihre englischen Rasen gar mehrmals täglich gießen.
Doch obwohl eine Studie weniger Grundwasser im Osten Österreichs voraussieht, macht die Wasserversorgung Wiens wenig Sorgen. "In der Wien-Rax-Hochschwab-Region könnten sich Sommer und Winter verschieben", sagt Karsten Schulz, der an der Universität für Bodenkultur das Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft leitet. Das heißt: Im Winter könnte es etwas mehr regnen; die Sommer könnten dürrer werden. An der gesamten Wassermenge sollte das aber nicht viel ändern.
Wien ist mit dieser besonderen Geografie gesegnet: Die Luftmassen, von den Alpen zum Aufsteigen gezwungen, kühlen und regnen ab -und gigantische Mengen fließen durch die Berge. Um für besonders trockene Zeiten gewappnet zu sein, hat die MA 31 aber Pläne gefasst. Ein neuer Rohrstrang für die Höllbachquelle, neue Rohre im Nordwesten und Süden Wiens, Speicher am Schafberg und in Liesing.
Hätte die Politik damals Donauwasser aus dem Wiener Becken geholt, hätten wir heute wohl mit niedrigem Grundwasser zu kämpfen. Egal mit wem man also spricht: Geologen, Wasserwirtschaftler, Immunologen, Historiker, alle loben die Stadt und ihre Mühen für das Wasser.
Natürlich gibt es da noch München, wo auch 95 Prozent des Trinkwassers aus Alpenquellen kommen. Berlin hingegen privatisierte die Wasserversorgung 1999 - um die Rechte zwölf Jahre später wieder zurückzukaufen. "Dass eine Stadt der Größe Wiens zur Gänze mit Hochquellwasser versorgt wird, ist schon ein Alleinstellungsmerkmal", sagt Peter Payer.
Auch diese Frage führt in die Zukunft. Denn es scheint kaum vorstellbar, dass Politiker ein Projekt dieser Größe und Vision heute noch einmal bauen würden. Die Zusammenarbeit, der Glaube an die Wissenschaft, das Bewusstsein, dass große Probleme radikale Antworten erfordern - das alles wirkt heute bei Verkehr, Energie und Kreislaufwirtschaft in weiter Ferne.
"Wien hat damals einfach wahnsinnigen Weitblick bewiesen", sagt Hans Tobler. Der Wassersommelier war schon am Nordkap, in der Wüste Afrikas, auf Dutzenden griechischen Inseln. Das weiche Wiener Wasser erkenne er immer. Und manchmal könne er sogar die Waldluft herausschmecken.
 Gebirgswasser für die Stadt
Gebirgswasser für die Stadt 






