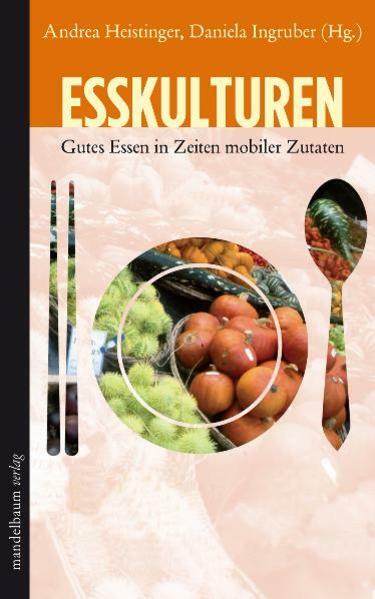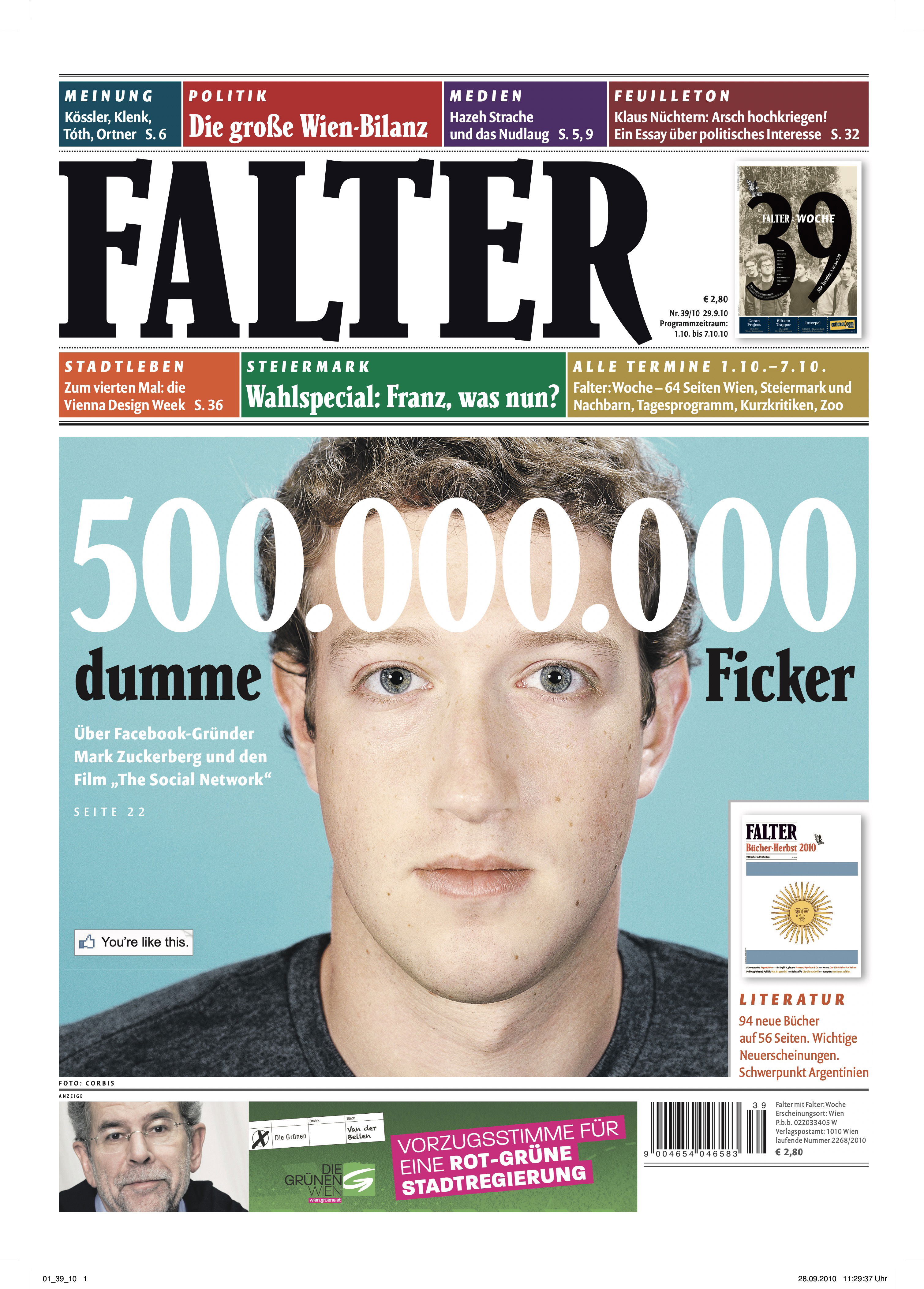
Herzlich willkommen in der Church of Actimel!
Christopher Wurmdobler in FALTER 39/2010 vom 29.09.2010 (S. 53)
Eigentlich ist jeder selbst schuld. Wer eine Tiefkühlpizza ins Backrohr schiebt und sich von den appetitlichen Bildern auf der Verpackung verführen lässt, statt aufmerksam das Kleingedruckte zu studieren, isst eben unter Umständen Schummelschinken mit weniger als 40 Prozent Fleischanteil und fiesen Analogkäse ohne Milch – Slowfood ist was anderes.
Es geht also um die Wurst, den Schwarzwälder Schinken und die beste Ernährung. Kaum ein Thema wird momentan so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Etwa in Thilo Bodes Buch "Die Essensfälscher". "Was uns die Lebensmittelkonzerne auf die Teller lügen", heißt es im Untertitel. Gutgläubig muss man halt auch sein – und sich vielleicht sogar belügen lassen wollen. Bode, der lange Manager bei der internationalen Umweltschutzorganisation Greenpeace war und 2002 die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch gründete, schaut in die Töpfe und hinter die bunten Verpackungen der Lebensmittelindustrie und deckt deren leere Versprechen auf. Zum Beispiel, dass man gesunde Vitamine in Bonbonform "naschen" kann, mit Margarine seine Cholesterinwerte senkt, mit probiotischem Joghurt die Abwehrkräfte stärkt oder die Verdauung in Schwung bringt.
Herzlich willkommen in der
Church of Actimel. Tatsächlich glaubt ein nicht unerheblicher Teil der Menschheit an den täglichen Gesundheits- oder Wellnessdrink. Man muss es offenbar nur oft genug im Werbefernsehen wiederholen, die wissenschaftliche Basis für das Produkt aus dem Kühlregal, so Bode, sei jedenfalls sehr dünn: Zwar könne die probiotische Joghurtkultur in Actimel ganz allgemein die "Aktivität körpereigener Immunzellen steigern", wie der Hersteller Danone verspricht – aber das können milchsaure Produkte wie Naturjoghurt, Kefir oder Sauerkraut ebenfalls. Und billiger.
Der Autor widerlegt nicht nur leere
Gesundheitsversprechen, mit denen die großen Nahrungsmittelkonzerne ihre oft sehr fetten oder überzuckerten Produkte anpreisen, um den Profit zu steigern. Bode zeigt, wie Kinder zu übergewichtigen Kunden von morgen gemacht werden. Er begibt sich auch auf die Suche nach der verlorenen Qualität und entlarvt die Traditionslüge. So wird den meisten Verbrauchern wohl entgangen sein, dass "Schwarzwälder Schinken" nicht unbedingt von Schweinen stammen muss, die sich im Schwarzwald gesuhlt haben. Der Schinken muss lediglich vor Ort hergestellt worden sein – egal ob das Fleisch (oder die Tiere) vor der indus-
triellen Massenfertigung tausende Kilometer hinter sich haben.
Wer nicht jeden Samstag regionale Produkte auf dem Bauernmarkt kauft, sondern sich und seine Familie weitgehend aus dem Supermarktregal ernährt oder ernähren muss, dem sollte klar sein, auf was er sich einlässt. Bode fordert mehr Transparenz und appelliert an die politisch Verantwortlichen, die Industrie stärker in die Pflicht zu nehmen. Die nämlich befürchtet offenbar Umsatzeinbußen, wenn auf der Verpackung groß und verständlich Inhaltsstoffe wie Fett und Zucker kommuniziert werden müssen. Die momentan diskutierte "Ampel" wäre eine Lösung. Auf der Tiefkühlpizza würde sie wahrscheinlich Rot anzeigen.
Noch ein Buch übers Essen, diesmal aber über das gute. Der Reader "Esskulturen. Gutes Essen in Zeiten mobiler Zutaten" von Andrea Heistinger und Daniela Ingruber versammelt Texte unterschiedlicher Autoren zu den Themenfeldern Ernährung, Kunst und Tradition. In dem Buch, das anlässlich der oberösterreichischen Landesausstellung 2011 "Mobile Food" erscheint, geht es dabei weniger um die tägliche Nahrungszufuhr als um das Essen als Event. Es geht um das Gemeinschaftserlebnis, den Herd als klassischen Mittelpunkt, Food-Design, gute Ernährung als Luxus oder als tägliche Überlebensstrategie wie bei der Versorgung von Hungernden in Afrika oder der Wiener Tafel, die überschüssige Lebensmittel Bedürftigen zukommen lässt: Es ist genug für alle da.
Festmäler, Rituale, Regionalität, alte Sorten und Nutztierrassen: Dem Kulturerbe als "Geschmackverstärker" widmet sich der Sozialanthropologe Christoph Kirchengast. Menschen sind in Bewegung, die Mobilität prägt auch Essgewohnheiten. Wie sich aufgrund veränderter Lebensumstände bodenständige Südtiroler Gerichte mit neuen Ernährungsgewohnheiten vermischen, erklärt die Ethnologin Barbara Stocker. Gerade diese Beiträge spannen einen überraschend großen Themenbogen zum Essen in der Kunst. Schließlich sollen ja die Esskulturen im Mittelpunkt stehen. Und nicht die große Essenslüge.