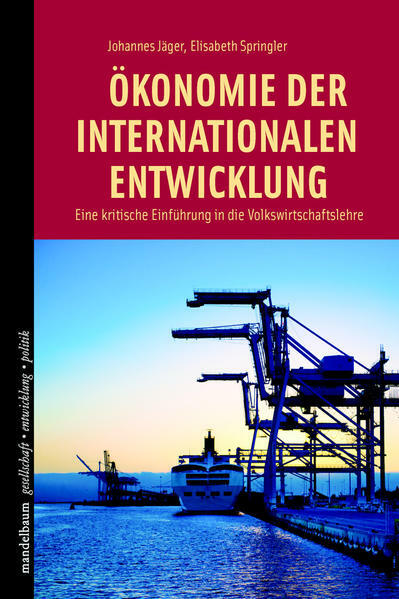Die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften
Manuel Melzer in FALTER 34/2014 vom 20.08.2014 (S. 57)
Johannes Jäger und Elisabeth Springler vergleichen ökonomische Denkweisen
Wie Ökonomie verstanden und erklärt wird, hat weitreichende Auswirkungen. Dies zeigt sich deutlich an den unterschiedlichen Erklärungen der aktuellen Wirtschaftskrise und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen an die Wirtschaftspolitik. Liegt die Lösung in "mehr Markt, weniger Staat" oder in einem massiven Eingreifen des Staates? Sollen wir den Kapitalismus als dysfunktionales System sehen oder als System, das bloß besser reguliert werden muss?
Obwohl sie nach Ausbruch der Krise in Verruf kamen, haben es marktliberale, neoklassische Erklärungsmuster und Handlungsempfehlungen geschafft, sich als Mainstream in den Wirtschaftswissenschaften zu behaupten. Ein einseitiger, eingeschränkter Blickwinkel birgt jedoch die Gefahr, dass – wie dies etwa im Vorfeld der Finanzkrise der Fall war – Problemstellungen schlicht übersehen oder nicht als solche erkannt werden.
Vor diesem Hintergrund ist das Buch "Ökonomie der Internationalen Entwicklung" von Elisabeth Springler und Johannes Jäger eine willkommene Abkehr zur etablierten Darstellung ökonomischer Grundlagen. Die beiden lehren Volkswirtschaft und stellen drei zentrale Denkweisen der Wirtschaftswissenschaften einander gegenüber. Neben der Neoklassik gehen sie auf die Grundlagen des Keynesianismus und der Politischen Ökonomie ein. Damit wollen sie die Basis für ein differenziertes Verständnis von Ökonomie und wirtschaftspolitischen Debatten für ein breites Publikum liefern.
Springler und Jäger gelingt dies dank des klaren und intuitiven Aufbaus des Buches. Anders als viele ökonomische Lehrbücher, die gleich damit beginnen, Schritt für Schritt ihre Modelle zu erklären, verortet "Ökonomie der Internationalen Entwicklung" zuerst deren Denkweisen, ehe zentrale ökonomische Themenfelder beleuchtet werden. Die Denkweisen werden dabei parallel dargestellt, um den direkten Vergleich zu ermöglichen.
Am Beginn stehen Fragen nach polit- und wirtschaftshistorischen Faktoren für Entstehung und Bedeutung der Denkströmungen. Diese Grundlagen werden durch die zentralen Methoden, die wissenschaftstheoretische Basis und die Grundkonzepte der drei Denkweisen vervollständigt. Der zweite, wesentlich umfangreichere Teil des Buches befasst sich in fünf Kapiteln mit zentralen ökonomischen Themenfeldern. Beleuchtet werden dabei die Themen Staat, Gesellschaft und Wirtschaft, Fragestellungen zu Wachstum, Entwicklung und Krise, gefolgt von Ungleichheit und Verteilung. Die letzten beiden Abschnitte befassen sich mit Geld und dem Finanzsystem und mit der Geografie der globalen Ökonomie. Veranschaulicht werden die Themen durch elf Vertiefungen von Gastautoren. Diese Kurzdarstellungen spannen einen weiten Bogen von Arbeits-, Wohlstands- und Verteilungsfragen über Klimawandel und Ressourcenpolitik bis hin zur feministischen Ökonomie.
Aus diesem Kurzabriss des Buches wird schnell ersichtlich, dass es sich um keine gemütliche Abendlektüre, sondern um ein Lehrbuch handelt. Den Anspruch, eine leichte Einführung für ein breites Publikum zu bieten, erfüllt das Buch – auch auf Grund der thematischen Dichte – nicht immer.
Doch zeigt es eindrucksvoll, wie vielfältig die Denkweisen in den Wirtschaftswissenschaften und wie unterschiedlich die Interpretationen zu verschiedenen Themen und Problemen sind. Dieser weite Zugang ist eine wichtige und willkommene Abwechslung zur Mainstream-Monokultur vieler Universitäten und Zeitschriften. All jenen, die ein Interesse daran haben, einen Einblick in die Breite wirtschaftswissenschaftlicher Denkweisen zu gewinnen und sich eine eigene Meinung zu bilden, kann dieses Buch daher nahegelegt werden.
Therapie zum Tod
Kurt Bayer in FALTER 9/2013 vom 27.02.2013 (S. 20)
Welche Folgen hat die europäische Krisenbekämpfung
im Süden? Eine Rechnungslegung am Beispiel Griechenland
Spanien, Portugal, Irland, Italien, Griechenland, Zypern – alle leiden derzeit am gleichen Problem. Und alle gehen mit demselben Rezept dagegen vor. Auf Druck der EU und internationaler Geldgeber heißt es: sparen. Damit soll die Produktivität gesteigert und die internationale Wettbewerbsfähigkeit hergestellt werden.
Doch was bewirkt die europäische Krisenbekämpfungspolitik? Das Beispiel Griechenland zeigt, was wohl auch auf alle anderen betroffenen Staaten mehr oder weniger zutrifft.
Dankbarkeit fordern viele Politiker des Nordens für die Hilfsgelder des Europäischen Rettungsschirms, die Griechenland stabilisieren sollen. Doch sie bleibt aus. Stattdessen bezeichnen Griechen die Troika aus EU, EZB und IWF, die die Rettungsmaßnahmen exekutiert, als "Destroika". Und angelehnt an die berühmten Worte des Sehers Laokoon in der "Aeneis" sagen sie "timeo Troika et dona ferens" – "Ich fürchte die Troika, auch wenn sie Geschenke bringt."
Die Undankbarkeit überrascht wenig, wenn man auf die Zahlen blickt. Sie zeigen einen Wirtschaftseinbruch in Griechenland, der an die Weltwirtschaftskrise 1929 oder an den Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 erinnert. Vereinzelte positive Nachrichten können nichts daran ändern, dass sich die Lage des Landes trotz aller Hilfsgelder nicht bessert, sondern verschlimmert.
Im Jahr 2007 verzeichnete das griechische Bruttoinlandsprodukt mit 211 Milliarden Euro seinen Höchststand. Seither ist es bis 2011 auf 180 Milliarden gefallen – und danach nochmals um sieben Prozent. Der Anteil der Investitionen am BIP sank von 27 Prozent 2007 auf derzeit 16 Prozent, womit die langfristigen Wachstumsaussichten stark beeinträchtigt werden. Trotz Hilfsgeldern und trotz Reformkurs erreichen die Maßnahmen ihr Ziel der Schuldenreduktion nicht – im Gegenteil, die Schuldenquote steigt immer weiter. Warum nur?
Diese Frage beantwortet ein Blick in die Budgetzahlen. Woraus genau besteht die laufende Schuldenlast Griechenlands? Im Jahr 2011 beispielsweise betrug das Staatsdefizit 20 Milliarden Euro, 9,5 Prozent des BIP. Wie kam es zustande? Ganze 15 Milliarden davon, also drei Viertel des Defizits, waren Zinsen, die für Staatsschulden fällig wurden. Als zweitgrößter Posten folgen Kosten für Sozialleistungen wie Arbeitslosengelder und Sozialhilfe. Dahinter kommen die Beamtenlöhne.
Bei Sozialleistungen und Beamtenlöhnen greifen inzwischen die massiven Sparmaßnahmen, die die Regierung auf Druck der Geldgeber setzt: Beide Posten sind zwischen Sommer 2011 und Sommer 2012 um mehr als 15 Prozent reduziert worden. Daran sieht man die Anstrengungen der griechischen Regierungen, ihre Kostentreiber einzuschränken – wenn auch um den Preis von Massendemonstrationen und drohendem Staatszerfall.
Insgesamt jedoch zeigt der Blick in die Budgetzahlen: Die Einsparungen machen bei weitem nicht wett, was der Strudel aus Arbeitslosigkeit, Verarmung und Sozialaufwendungen das Land kostet. Die gesamten Staatsausgaben sind zwischen 2007 und 2011 nicht etwa gesunken, sondern krisenbedingt um fast zehn Prozent gestiegen, was derzeit zu einer Ausgabenquote am BIP von 52 Prozent führt. Der Großteil dieser Ausgabensteigerungen resultiert also nicht etwa aus dem, was man Griechenland gern und mit einigem Recht vorwirft: der jahrzehntelangen Misswirtschaft; sie sind stattdessen eine unmittelbare Folge der Krisenbewältigung.
Diese Kosten ließen sich reduzieren, wenn die Sparmaßnahmen weniger drastisch gesetzt oder etwa von Investitionsprogrammen begleitet würden. Doch dem stehen die Geberländer entgegen, die sogenannte "Strukturreformen" fordern.
Die Zahl der Arbeitslosen beispielsweise, die vor der Krise etwa 420.000 betragen hatte, ist insbesondere seit 2010 sprunghaft angestiegen. Derzeit beträgt die Rate 26,8 Prozent, Ende 2011 waren es noch 20,8 Prozent. Besonders katastrophal ist die hohe Anzahl von jugendlichen Arbeitslosen. Die Rate lag Ende 2011 noch bei 50 Prozent; inzwischen ist sie laut Eurostat auf 67,5 Prozent gestiegen, über zwei Drittel der Jugendlichen unter 25 Jahren.
In Österreich hat man sich trotz der ungleich besseren Situation des Landes entschlossen, große Mittel für Schulungsprogramme, Kurzarbeitsunterstützung und Ausbildungsgarantien einzusetzen. Dies verhindert die soziale Ausgrenzung vor allem von Jugendlichen. In Griechenland jedoch ist dergleichen aufgrund des Sparkurses nicht möglich.
Fazit: Nicht nur wirtschaftspolitische Fehler griechischer Regierungen, sondern auch die Auflagen von EU und Troika haben zur fast existenziellen Krise des Landes geführt. Die Hilfszusagen der internationalen Gemeinschaft haben bisher zwar einen Staatsbankrott verhindert – wenn man den Schuldenschnitt im Frühjahr 2012 und den später verhandelten "freiwilligen" Anleihenrückkauf nicht als solchen bezeichnen will. Durch die Auflagen wurde das Land jedoch in eine tiefe Rezession getrieben, mit extrem hohen Arbeitslosenraten und Einkommensverlusten für die Bevölkerung. Das als hehr gepriesene Ziel, die griechische Staatsschuldenquote bis 2020 auf 124 Prozent zu drücken, wird so nicht erreichbar sein.
Bei den Hilfspaketen – in Griechenland wie anderswo – kommt die notwendige Steigerung der Wachstumschancen der Wirtschaft zu kurz. Dadurch wird das Wachstum eingebremst, die Arbeitslosigkeit erhöht und die Möglichkeit, die Schuldenlast zu bedienen, reduziert.
Diese Strategie ist nicht nur humanitär katastrophal, sondern politisch äußerst gefährlich. Denn Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben, werden zunehmend radikalisiert. Das ebnet den Weg für populistische Vereinfacher.
Der Staat in der Wirtschaft
Markus Marterbauer in FALTER 6/2013 vom 06.02.2013 (S. 19)
Die Finanzkrise hat auch die Wirtschaftswissenschaft in eine Krise gestürzt. Die Lehrbücher verkünden noch immer die segensreiche Wirkung unregulierter Finanzmärkte oder die Unschädlichkeit der Austeritätspolitik in Bezug auf Beschäftigung und Konjunktur, obwohl diese Thesen durch die empirischen Fakten widerlegt sind. Johannes Jäger und Elisabeth Springler schaffen mit ihrer Einführung in die Volkswirtschaftslehre endlich Abhilfe. Nicht indem sie dem neoliberalen Mainstream einfach einen kritischen Gegenentwurf gegenüberstellen. Sondern indem das Buch die ökonomischen Schulen Neoklassik, Keynesianismus und Politische Ökonomie ausführlich darstellt und anhand konkreter und aktueller Fragestellungen etwa zu den Aufgaben des Staates in der Wirtschaft klarmacht. Damit liegt ein Band vor, der Einsteigern und Experten ans Herz gelegt werden kann.