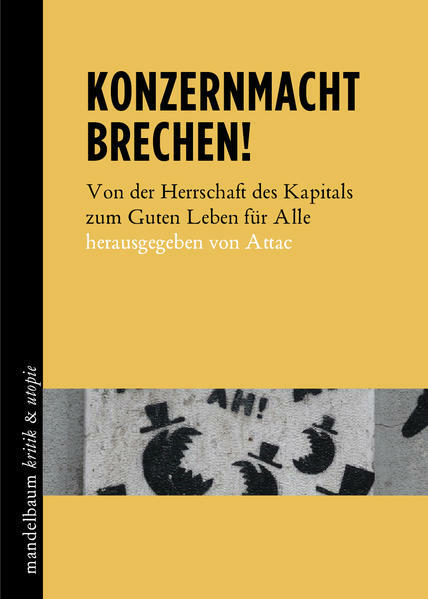Die Macht der Konzerne brechen, aber wie?
Markus Marterbauer in FALTER 18/2016 vom 04.05.2016 (S. 22)
Die transnationalen Konzerne verfügen über gefährlichen Einfluss auf die Politik ohne jede Legitimation
Erst vor drei Monaten blickte die ganze Welt nach Davos: Beim Weltwirtschaftsforum (WEF) trafen einander im Jänner die Generaldirektoren der tausend Mitgliedsunternehmen. Auf Einladung teilnehmen durften auch mehrere hundert Gäste aus Politik, Wissenschaft und Medien, um in öffentlich-privater Partnerschaft „den Zustand der Welt zu verbessern“, wie es auf der Homepage des WEF heißt. Wer sollte da dagegen sein?
In vier Monaten wird das WEF seinen „Global Competitiveness Report“ veröffentlichen, der 140 Länder der Welt nach ihrer Wettbewerbsfähigkeit reiht. Journalisten lieben das Ranking, vor allem jene, die im Jänner in Davos waren, und auch jene, die noch eingeladen werden wollen. Seine Basis bilden Befragungen von Unternehmensführern. In Österreich wird das Ranking wieder Anlass zu kollektiver Sorge geben, zum Beispiel durch die Beurteilung der Effizienz des Arbeitsmarktes: Hier lag Österreich beim letzten Mal auf Rang 40 von 140. Hinter Ruanda, Kasachstan, Uganda, Nigeria und Kambodscha und noch ganz knapp vor der Mongolei und Madagaskar. Kein Schmäh! Der Grund: Die Manager halten das bewährte Kollektivvertragssystem für unflexibel, sie möchten Mindestlöhne und Arbeitszeiten lieber selbst festsetzen.
Harte Fakten zählen wenig: Österreich hat eine der höchsten Wirtschaftsleistungen pro Kopf, die Industrieproduktion läuft etwas besser als die deutsche, Investitions- und Forschungsquote liegen an der Spitze Europas. Doch mit der Stimmung der Managerelite wird Politik gemacht: Das Ranking soll Anreiz sein, sich „zu verbessern“, das heißt den Arbeitsmarkt schleunigst zu flexibilisieren.
Der Drehtüreffekt
Was aber legitimiert die Unternehmensführer, Weichen für die Politik zu stellen? Ihre wirtschaftliche Macht, die sie die Politik spüren lassen können? Der Drehtüreffekt, der so manchen gerade aus der Politik in die Konzern- und Finanzwelt gespült hat oder bald wieder in die Politik führen wird? Beispiel Jonathan Hill: Noch vor kurzem Finanzlobbyist, heute britischer EU-Kommissar für Finanzstabilität und verantwortlich für die Pläne zur Kapitalmarktunion, dem neuen Lieblings-Deregulierungsprojekt der Finanzkonzerne. Oder die von ihnen bezahlten Lobbyisten, die in Brüssel hundert Mal so zahlreich sind wie die Aktivisten im Auftrag von Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften?
Diese Fragen stellt das neue Attac-Buch zur Konzernmacht. Es wurde in Kooperation mit dem Transnational Institute herausgegeben und versammelt deshalb viele prominente internationale Stimmen zum wachsenden Einfluss transnationaler Konzerne auf gesellschaftliche und politische Gestaltungsspielräume. Zum Beispiel jene der Politikwissenschaftlerin Susan George, der Präsidentin des TNI, oder des Sozialwissenschaftlers David Sogge, der sich mit dem WEF Davos auseinandersetzt.
Grassierender Lobbyismus
Sie sehen den grassierenden Lobbyismus der Konzerne in Brüssel und Washington und die von ihnen finanzierten Stiftungen und Think-Tanks als Gefahr für die Demokratie und zeigen dies am Beispiel des Transatlantic Trade and Investment Pact (TTIP), wesentlich vorangetrieben von Lobby-Organisationen wie dem European Round Table of Industrialists, einem Zusammenschluss von 50 europäischen Konzernbossen. „Jedes Mitglied des ERT hat Zugriff auf die höchsten Regierungskreise“ preist sein Mitglied Peter Sutherland, ehemaliger Leiter von Goldman Sachs, Britisch Petrol und ehemaliger EU-Kommissar, die Organisation. Die Konzerne üben Macht aus, ohne demokratisch legitimiert zu sein und die dazugehörige Verantwortung wahrzunehmen.
Oder am Beispiel der Finanztransaktionssteuer, des jahrzehntelangen Attac-Projekts zur Eindämmung der Finanzspekulation. Mit der von Finanzmärkten und Banken ausgelösten Wirtschaftskrise bot sich plötzlich ein Window of Opportunity zu seiner Umsetzung. Doch nach und nach gelang es Lobbygruppen wie der Swaps and Derivates Association und dem ERT, das Konzept in der Europäischen Kommission und im Europäischen Parlament zu verwässern und schrittweise zu begraben.
Weitere Buchkapitel zeigen den Einfluss der Konzernlobbys bei der Verhinderung effektiver Maßnahmen gegen den Klimawandel, die Auslieferung des weltweiten Agrar-und Ernährungssystems an die Interessen transnationaler Konzerne oder ihre schleichende Kaperung des Rechtssystems. Ein Beitrag befasst sich auch mit der Macht der Konzerne in Österreich und dem wirtschaftlich und politisch am besten vernetzten Player der „Österreich AG“, dem Raiffeisen Komplex. Der grüne Riese übt seinen Einfluss gerne still aus, über seine vielfältigen Beteiligungen im Bankensektor, in der Nahrungsmittelindustrie, den Medien, der Wissenschaft und der Politik.
Was können soziale Bewegungen und die Zivilgesellschaft gegen die wachsende Konzernmacht tun? Attac propagiert den aktiven gesellschaftlichen Widerstand, zum Beispiel durch die Verhinderung von TTIP, und den Aufbau alternativer Wirtschaftssysteme von unten, etwa durch die Ausweitung frei verfügbarer Software (Open Source). Dann die Bewahrung und Ausweitung gemeinwirtschaftlicher und öffentlicher Wirtschaftsbereiche, die Wirtschaften ohne die Profitlogik der Konzerne ermöglicht, und die Verteidigung einer demokratischen Rechtsordnung, die die Konzernmacht begrenzt. Erstaunlich wenig Aufmerksamkeit wird dabei dem Wettbewerbs- und Kartellrecht gewidmet, einem zentralen Instrument der Beschränkung von Konzerninteressen. Schließlich die Ausweitung demokratischen Einflusses und öffentlicher Räume, um den Sumpf des Lobbyismus auszutrocknen.