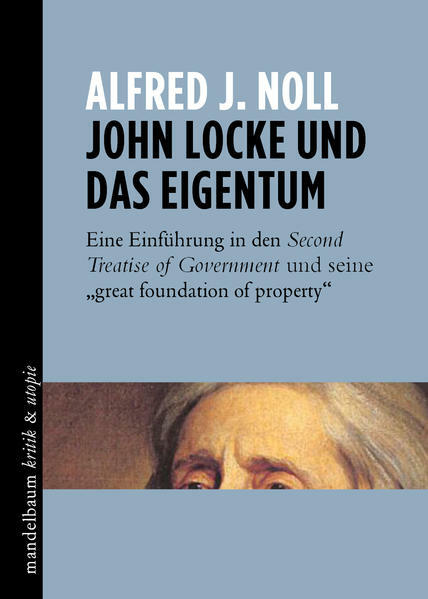John Locke, Theoretiker des Minimalstaates
Alfred J. Noll in FALTER 3/2017 vom 18.01.2017 (S. 52)
John Locke begründete die Lehre vom Eigentum und wirkte gerade wegen deren Unvollkommenheit
John Locke ist der Liebling bürgerlicher Selbstbeschreibung. Aus seinen Werken – vor allem „An Essay Concerning Humane Understanding“ und „The Second Treatise of Civil Government“ (beide 1690 erschienen) – lässt sich all das herauslesen, was auch heute noch brauchbar scheint. Kein anderer Autor ist weltanschaulich derart verwertbar geblieben wie John Locke.
Er ist nicht anrüchig, weil er die schroffe Folgerichtigkeit des Thomas Hobbes derart abmildert, dass die doch bei Locke ebenso streng den staatlichen Gesetzen unterworfenen Gesellschaftsmitglieder stets in den Glauben versetzt werden, sie wären der Souverän.
Er ist in jeder Sonntagsrede zu geringstem Preis anzubringen, weil er jegliche Herrschaft dem Volkswillen unterordnet und diesem sogar das Widerstandsrecht gegen allzu strenge Herrschaft einräumt und sich damit zum eigentlichen Begründer unveräußerlicher allgemeiner Menschenrechte hochstilisieren lässt – er ist „einer von uns“.
Er ist politisch stets zeitgemäß, weil er die Gewaltenteilung und das Mehrheitsprinzip benennt, und damit die Illusion verbreiten hilft, dass bürgerliche Herrschaft dieser Art unmittelbarer Ausdruck des Volkswillens sei und lediglich um eine funktionierende Justiz sich vervollständigen lassen müsse.
Er ist für die Volkswirtschaftslehre bis hinein zu den bezahlten Wirtschaftsperiodika immer noch grundsätzlich, weil seine vor allem auf Adam Smith wirkende und auf Arbeit gegründete Eigentumslehre und die darin zum Ausdruck kommenden Einsichten sich in vielerlei Hinsicht weiterverfolgen lassen.
Er ist bis heute politisch unverdächtig, weil sich doch fast die ganze Aufklärungsliteratur positiv auf ihn bezogen hat; weil er mit allen Facetten seines Werkes durch eine moderate und stets wohltemperierte Sprache für unaufgeregte Sachlichkeit sorgt. Und rühmlich schlussendlich ist Locke, weil er bis heute als einer der konstruktiven Vordenker der US-amerikanischen Revolution und der dort nachfolgenden Verfassung gilt.
Das Wichtigste aber: John Locke hat das Eigentum geheiligt. Er hat die sich notwendig aus dieser Heiligsprechung ergebende gesellschaftliche Ungleichheit als nicht weiter bedauerlich abgehandelt, und er hat schließlich jeden Angriff auf das Privateigentum als mit den von Gott und der Natur, von der Vernunft und den Erfahrungen kommenden Einsichten unvereinbar, unverträglich und sogar sündhaft bestimmt.
Vom Kleinbürger mit seinem hypothekenbelasteten Eigenheim bis hin zum Hedge-
fonds-Manager mit der Zuversicht, demnächst sein neues Appartement in der New Yorker 5th Avenue beziehen zu dürfen, können sich alle von John Locke bestätigen lassen. Ein derartiges Geistesmonument will nicht gestürzt, es will bewundert werden. Dafür gibt es aber – selbst wenn wir die sklavenhändlerische Betriebsamkeit und die kolonialistische Legitimationsarbeit von Locke als bloß zeitbedingte Charakterschwächen des Mannes beiseite ließen – keinen Grund.
Ähnliches wie Locke haben in den vergangenen Jahrhunderten viele publiziert. Weder war er besonders konsequent noch hat er besonders einnehmend geschrieben, weder war er besonders originell noch sind seinem Werk besonders innovative gedankliche Leistungen ablesbar, weder war er besonders mutig noch hat er andere durch seine Schriften ermutigt. Aber er hatte Erfolg – bis heute.
Ist die damit attestierte Zeittauglichkeit also der einzige Grund für den Erfolg der Locke’schen Theorie? Lässt sich damit erklären, dass auch heute noch, gut 300 Jahren nach den „Two Treatises“, Locke als der Säulenheilige der Menschenrechte und der Gewaltenteilung gehandelt wird? – Wohl kaum.
Indem Locke verkündet, die Funktionen des Staates seien um der Freiheit der Menschen willen auf ein absolutes Minimum zu beschränken, und gleichzeitig ausspricht, dass der Staat nur unter ganz bestimmten, rational definierbaren Bedingungen in die (Eigentums-)Freiheit seiner Bürger eingreifen dürfe, macht Locke sich zum Theoretiker eines negativen Staates (Minimalstaat).
Dieser Staat aber, der sogenannte „Nachtwächter“-Staat, hat sich im Laufe von inzwischen mehreren Jahrhunderten in England nicht nur als fähig erwiesen, die für einen sich entwickelnden Kapitalismus notwendige staatliche Infrastruktur zu errichten, die Arbeiterbewegung niederzuhalten und ein (wenn auch vergängliches) ungeheures Kolonialreich zu errichten, sondern dieser Staat führt auch in der Gegenwart Kriege, betreibt internationale Handelspolitik zugunsten des britischen Kapitals und rüstet sich auf zu einem omnipotenten Überwachungsstaat. Der „negative“ Staat war immer schon ein höchst aktiver Staat. Dies lässt sich mit Locke „ganz seriös“ kaschieren.
Hier liegt die Ursache der fast schon magnetisch zu nennenden Anziehungskraft des Locke’schen Ansatzes: Locke kanonisiert eine kleinbürgerliche Dynamik, in der die durch und durch positiv gewerteten Elemente der „Gleichheit“, der „Herrschaftslosigkeit“ und der „Kalkulierbarkeit“ in einen scheinbar einheitlichen konzeptionell-weltanschaulichen Rahmen gestellt werden. Lockes Rede von der Freiheit passt vortrefflich zum unbedingten Gehorsam gegenüber den staatlichen Gesetzen, die de facto das Werk von Menschen sind, die vermittels dieser Gesetze ihre Interessen wirksam durchzusetzen in der Lage sind.
All dies passt in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der letzten 300 Jahre, in denen durchwegs und in zunehmendem Maße der Gewinn einiger weniger von den Apologeten und Klaqueuren des Wirtschaftsliberalismus stets als ein Fortschritt für alle verkauft werden will.
Nun dürfte gewiss sein, dass Lockes Theorie begrifflich unbestimmt und als Rechtstheorie inkonsequent ist. Gerade aus dieser Unvollkommenheit bezieht sie aber ihre ideologische Wirkung – und eben darauf beruht auch ihre ganze eigentümliche Leistung und ihre über den unmittelbaren historisch-sozialen Kontext hinausreichende, bis heute in vielfach wechselnden politisch-sozialen Konstellationen bestätigte Bedeutung, und zwar als Theorie der politisch-ideologischen Erfordernisse einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft.
Die Widersprüche in Lockes Konzeption des Naturrechts, des Naturzustandes, des Rechts auf private Aneignung und seiner Staatstheorie werden nur verständlich als Elemente einer ideologischen Argumentation, in der es nicht auf theoretisch-logische Konsistenz, sondern auf suggestive Überzeugung ankommt, dem der partielle Wahrheitsgehalt dieser Elemente vorzüglich dient.
Locke hat mit seinem Weltanschauungstraktat das Kunststück zuwege gebracht, für die nächsten Jahrhunderte jene „irreale Gegenständlichkeit der Staatsverfassung“ (Husserl) zu fundieren, von der bis heute das konservative Allerweltsgerede zehrt.
Die damit nicht nur von Locke, sondern von einer ganzen Heerschar von Nachfolgern erzeugten Illusionen und Erwartungen an das aus dem unbekämpften und unkritisierbaren Privateigentum resultierende individuelle und gesellschaftliche Heil lassen es heute als nahezu verrückt erscheinen, was doch aus vielerlei Gründen naheliegt: das System unbeschränkter und unbeschränkbarer privater Aneignung endlich zu überwinden.
Locke war ein begnadeter Synthetisierer. Er verdeckte die Widersprüche zwischen den Ideen, die er zusammenbrachte, und gewann damit breite Akzeptanz für seinen wissenschaftlich-materialistischen Ansatz. Aus demselben Grunde aber divergierten die Anhänger Lockes in solche von rechts und von links bis heute, je nachdem, ob sie die eine oder andere Seite des Kompromisses betonten: entweder das unbeschränkte Eigentumsrecht oder die Herkunft solcher Rechte aus der Arbeit.
Locke kann „groß“ genannt werden, weil er die Hauptsache kapitalistischer Vergesellschaftung zu seinem hervorragenden Thema gemacht hat.