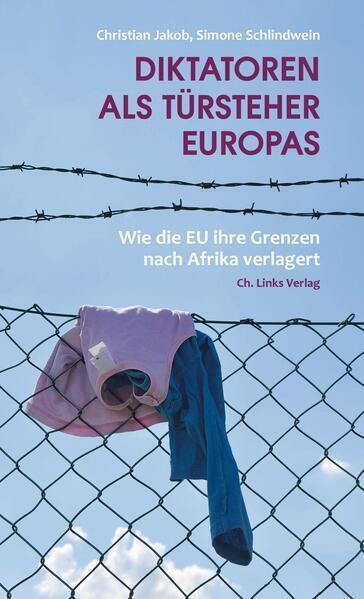Europas neue Mauern auf dem afrikanischen Kontinent
Benjamin Breitegger in FALTER 42/2017 vom 18.10.2017 (S. 20)
Zwei taz-Journalisten analysieren, wie sich die Europäische Union abschottet – und dabei mit autoritären Regimen zusammenarbeitet
Hunderttausende Afrikaner machten sich in den vergangenen Jahren auf der Flucht vor Armut und Verfolgung auf den langen Weg nach Europa. Im Wahlkampf wiederholten die österreichischen Großparteien die Forderung, die Grenzen dichtzumachen. In Deutschland diskutierten Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD) in ihrer einzigen Fernsehdebatte ausgiebig über Flüchtlinge. Der afrikanische Kontinent ist ins innenpolitische Zentrum gerückt.
Das ist neu – und es hat Konsequenzen. Simone Schlindwein, die seit neun Jahren als Afrika-Korrespondentin der Berliner Tageszeitung (taz) in Uganda lebt, und ihr Kollege Christian Jakob beschreiben, welche: Europa investiert in innerafrikanische Grenzen. Dabei arbeitet die EU selbst mit autoritären Regimen zusammen. Hinter schönen Worten zu mehr Entwicklungshilfe steckt ein übergeordnetes Ziel: zu verhindern, dass noch mehr Afrikaner nach Europa kommen.
Die Autoren zerlegen anfangs den Mythos, dass dieser Migrationsstrom global einzigartig sei. „Afrikaner in Europa – unter den Migranten dieser Welt ist ihre Zahl so gering, dass sie nicht in der (Weltbank-)Liste der Top 30 auftauchen“, schreiben sie. Geht es um Flüchtlinge, sind die Zahlen ähnlich niedrig: Europa versorgt laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk sechs Prozent weltweit.
Dass sich Europa vor ihnen abschottet, ist nicht neu. Die österreichische Journalistin Corinna Milborn hat es bereits 2006 in ihrem Buch „Gestürmte Festung Europa“ beschrieben. Flucht auf die Kanarischen Inseln wurde durch Kooperationen mit Anrainerstaaten verhindert, die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla bauten immer höhere Zäune.
Tausende starben unbemerkt im Mittelmeer. Diese Entwicklung zeichnen die Autoren im ersten Teil ihres Buches nach, um danach faktenreich zu analysieren, was in den vergangenen Jahren geschah. Denn nun gebe es eine „Ballung diplomatischer Betriebsamkeit“ und eine „Extraportion Entwicklungshilfe für die Koalition der Willigen in Sachen Grenzschutz“.
Sudans Grenzwächtereinheit
Der Sudan dient ihnen als ein Beispiel. Die EU sicherte dem ostafrikanischen Land im Rahmen des „Better Migration Management“ am Horn von Afrika 40 Millionen Euro zu, um „Menschenhandel und Schleusertum einzudämmen“.
Sudans neue Grenzwächtereinheit ist jedoch eine ehemalige Miliz, die UN-Ermittler für Menschenrechtsverbrechen verantwortlich machen. Gegen Sudans Präsident Umar al-Baschir verhängte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen im Darfur-Konflikt (eingestellt 2014 wegen fehlender Kooperation des UN-Sicherheitsrates). Die EU versichert, dass Ausbilder lokale Grenzbehörden einen menschenwürdigen Umgang mit Migranten lehren. Vor Ort arbeiten NGOs. Das führen die Autoren an. Doch ihre Skepsis an der Zusammenarbeit ist angebracht, denn die EU konzentriert sich mit ihrer Hilfe zunehmend auf Transitländer von Migranten. Es bleiben dennoch komplizierte Fragen offen: Sollte die EU gar nicht mit autoritären Regimen wie Sudan oder dem angrenzenden Eritrea arbeiten? Was ist die beste Lösung für die lokale Bevölkerung?
Fluchtursachenbekämpfung
Nicht nur im Sudan, sondern auch in Niger in Westafrika investiert die EU in Grenzschutz. Das halten afrikanische Regierungen wegen des Terrors einerseits selbst für notwendig, schreiben die Autoren. Es hätte aber auch gefährliche Folgen: Das Ziel der Freizügigkeit von Ecowas, der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, werde unterminiert. Dabei sei Arbeitsmigration innerhalb Afrikas ein zentraler wirtschaftlicher Faktor. Und Menschen, die nach Europa flüchten wollen, suchen sich immer gefährlichere Wege durch die Wüste.
Seit einiger Zeit wird deshalb ein neues Schlagwort bemüht: Fluchtursachenbekämpfung. Armut soll bekämpft werden, mit dem Ziel, irreguläre Migration zu verhindern. Für die Autoren ist es das neue Paradigma der Entwicklungszusammenarbeit. Manches werde zwar nur umetikettiert. Doch die EU kündigte auch diverse neue Aktionspläne und Finanzierungshilfen an.
Jakob und Schlindwein listen verschiedenste Millionenprogramme auf und gestehen ein, dass es schwerfällt, hier den Überblick zu bewahren. Manchmal verliert sich dann der Leser – und wohl auch so manch zuständiger Politiker – in Zahlen: Wie viele Millionen Hilfe versprach wer aus welchem Topf wem? Welche Hilfsprogramme erschienen mit neuen Namen und Versprechungen, finanzieren sich aber aus bereits genehmigten Budgets?
Klar wird, dass das neu erwachte Interesse am afrikanischen Kontinent durch Migration nach Europa bedingt ist. Den Autoren gelingt nicht nur, in schnörkelloser Sprache, ein gelungener Überblick darüber, wie Europa irreguläre Migration verhindert und welche Folgen das für die betroffenen Menschen hat. Sie zeigen auch auf, wie sich Diskurse rund um Migration verschoben haben. Als trotz der EU-Investitionen weiter zehntausende Flüchtlinge kamen, machten Politiker zuletzt die privaten Seeretter verantwortlich, und die EU-Staaten ließen den Mittelmeer-Anrainerstaat Italien alleine.
Neue Grenzen, schreiben die Autoren abschließend, helfen der EU. Afrikas Wirtschaft profitiere davon nicht – im Gegenteil. Überweisungen von Migranten in die Heimat seien ein entscheidender Faktor für die lokale Wirtschaft. Dieser sei nicht mit noch mehr Entwicklungshilfe nachzukommen. Es gelte auch, die Handelspolitik zu hinterfragen, um die neue „Partnerschaft“ zwischen der EU und Afrika zu einer werden zu lassen.