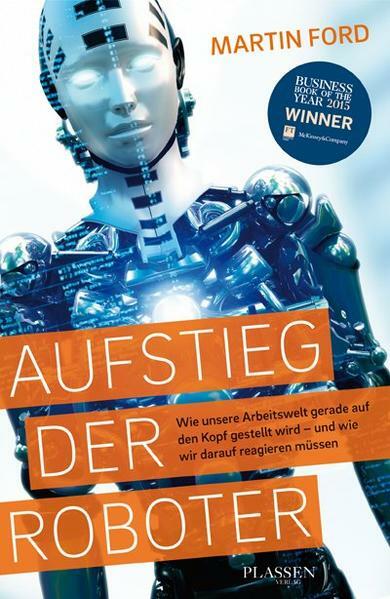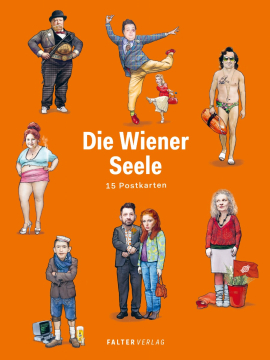Die sieben Todsünden der modernen Raubritter
Wilfried Altzinger in FALTER 45/2016 vom 09.11.2016 (S. 20)
Wieso teilt sich eine kleine Elite das gesamte Technologiekapital auf? Der Amerikaner Martin Ford stellt die richtigen Fragen
Martin Ford hat eine Softwareentwicklungsfirma im Silicon Valley gegründet und ist seit mehr als 25 Jahren in den Bereichen Computerdesign und Softwareentwicklung tätig. In seinem Buch „Aufstieg der Roboter“ zeichnet Ford detailliert die Entwicklungen des technischen Fortschritts und dessen Auswirkungen auf die Arbeitswelt nach.
Dabei geht es nicht nur um selbstfahrende Autos, um den Ersatz von Lehrkräften an den Universitäten durch Onlinekurse oder um den Ersatz von Ärzten durch von Algorithmen künstlicher Intelligenz erstellte Diagnosen, sondern auch um selbstlernende Maschinen.
Eine zentrale Botschaft des Buchs ist, dass informationstechnologische Änderungen überall um sich greifen. Dabei sieht Ford die aktuellen Entwicklungen in Richtung größerer Ungleichheit durch diese Technologien schon mitverursacht. Ford, selbst kein Feind der Technik, zeigt, dass der technische Fortschritt nicht nur mit steigender Produktivität verbunden ist, sondern auch mit negativen Folgen für den Arbeitsmarkt. Freisetzungseffekte und Einkommensverluste in großem Ausmaß werden laut Ford die zwangsläufigen Folgen sein.
Martin Ford setzt sich somit nicht nur mit den technologischen Entwicklungen auseinander, sondern auch mit deren gesellschaftlichen Implikationen. Dabei weist Ford auf „sieben tödliche Trends“ hin, welche er für die USA in den vergangenen 30 Jahren beobachtet: stagnierende Löhne, steigende Unternehmensgewinne, rückläufige Erwerbsquoten, steigende Langzeitarbeitslosigkeit, wachsende Ungleichheiten, Polarisierung und Prekarisierung der Arbeitsmärkte.
Ford erklärt diese Entwicklungen zwar überwiegend durch die neuen Technologien, nennt dabei aber auch Globalisierung, die Liberalisierung der Finanzmärkte sowie die Politik als weitere Determinanten dieser Entwicklungen.
Die neue Tech-Elite
Der Zusammenhang zwischen neuen Technologien und deren Konsequenzen für die Verteilung wird am Beispiel der Informationstechnologie dargelegt: Kontrolliert ein Konzern einen großen Markt, summieren sich schon kleinste Ertragsmargen rasch zu enorm hohen Umsätzen und Gewinnen auf.
Dies wird an den Beispielen der Konzerne Apple, Facebook, Google und Amazon anschaulich illustriert. Diese Entwicklung wirft für Ford eine sehr wesentliche Frage zum Wirtschaftssystem auf: „Die grundlegende moralische Frage lautet, ob es einer kleinen Elite gestattet sein soll, das angehäufte Technologiekapital der gesamten Gesellschaft unter sich aufzuteilen.“
Die ökonomischen Konsequenzen von Fords technologischem Befund sind sehr klar: Kapital substituiert Arbeit – und zwar in naher Zukunft möglicherweise noch stärker als in der Vergangenheit. Durch den damit verbundenen Anstieg der Arbeitslosigkeit gehen die Kaufkraft und somit auch der private Konsum zurück. Weder private Investitionen noch die staatliche Nachfrage werden diesen Nachfrageausfall kompensieren können, da die einen durch die mangelnde Nachfrage, die anderen durch die erreichten Verschuldungsstände stark beschränkt sind. Der Weg in die Wachstumsschwäche wäre somit vorgezeichnet.
Grundeinkommensproletariat
Martin Fords favorisierte Antwort auf die Herausforderung der neuen Technologien ist das bedingungslose Grundeinkommen. Er meint, dass die Menschen damit nicht nur wieder Kaufkraft bekommen, sondern darüber hinaus auch innovativer und risikobereiter werden, wenn sie existenzieller Ängste entledigt werden.
Ohne hier das Konzept des Grundeinkommens debattieren zu können, sei nur festgehalten, dass es neben dem Grundeinkommen auch noch zahlreiche andere Maßnahmen gäbe, die unerwünschten Verteilungswirkungen entgegensteuern könnten. Ford ist jedoch – zumindest an dieser Stelle – ein großer Skeptiker gegenüber staatlichen Eingriffen. So schreibt er: „Weisen wir Hayeks marktorientierte Lösung (des Grundeinkommens, W.A.) zurück, bleibt nur noch eine Lösung: die Ausweitung des traditionellen Sozialstaates, inklusive aller damit einhergehenden Probleme.“ Noch deutlicher kann die US-amerikanische Grundskepsis gegenüber staatlichen Eingriffen nicht zum Ausdruck gebracht werden.
Interessant ist, dass Martin Ford bei der Diskussion über die Finanzierung des Grundeinkommens stark von dieser liberalen Position abweicht. Dort schlägt er neben CO2-Steuern, Mehrwertsteuer, Unternehmens- und Grundbesteuerung die Beseitigung von diversen Steuerbegünstigungen, eine Kapitalertragsteuer sowie die Finanztransaktionssteuer vor. Darüber hinaus diskutiert Martin Ford auch eine globale Vermögenssteuer, deren Umsetzung er nicht für unmöglich erachtet. Auch die Frage von zentral gelenkten staatlichen Investitionsfonds à la Norwegen oder Alaska wird diskutiert.
Wenngleich in dieser Debatte noch viele Punkte offenbleiben, ist es sicherlich ein großes Verdienst von Ford, dass technologische Entwicklungen und Verteilungsfragen gemeinsam diskutiert werden. Liest man dazu aktuelle Befunde wie den Economist-Report über die mächtigsten Unternehmen der Welt vom 17. September dieses Jahres nach („In the Shadow of Giants“), wird
diese Problematik dramatisch unterstrichen: „The superstar effect is particularly marked in the knowledge economy. In Silicon
Valley a handful of giants are enjoying market shares and profit margins not seen since the robber barons in the late 19th century.“ Martin Ford liefert mit seinem Buch in
dieser Hinsicht wertvolles Anschauungsmaterial.