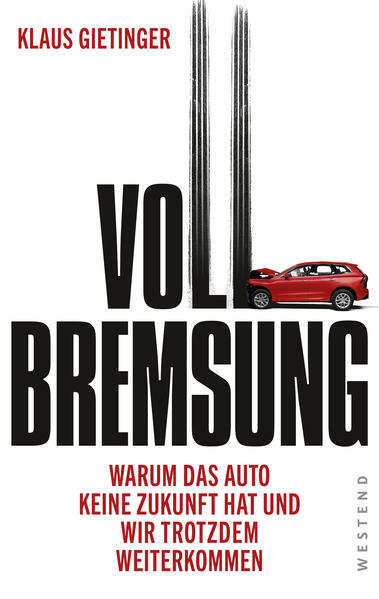Wie der Wahnsinn auf vier Rädern die Welt zerstört
Rudolf Walther in FALTER 37/2019 vom 11.09.2019 (S. 19)
Autor Klaus Gietinger kritisiert zu Recht den tödlichen Autowahnsinn, schwächt seine Argumente aber durch Alarmismus und Panikmache
Es gibt zwei Formen von Zombie-Technologien. Die Anwendung der ersten bewirkt langfristig nicht korrigierbare Schäden und unberechenbare Risiken und Folgekosten. Zu dieser Sorte gehören die Nutzung der Atomkraft, der Kohlebergbau und der Abbau seltener Metalle und Erden. Die zweite Art stellt sich schon vor der Anwendung im großen Stil als Bumerang heraus. Das ist der Fall bei der individuellen Motorisierung, die in Staus kollabiert, bevor sich alle in Autos bewegen. Langfristig zeitigt diese Technologie allerdings dasselbe Resultat wie die erste Art.
1,35 Millionen Tote auf den Straßen
Insofern ist es höchste Zeit für ein Buch mit dem Titel „Vollbremsung. Warum das Auto keine Zukunft hat und wir trotzdem weiterkommen“. Weltweit sterben täglich 3700 Menschen im Straßenverkehr, jährlich rund 1,35 Millionen. Momentan verkehren weltweit aber „nur“ 1,5 Milliarden Pkw, bis 2030 werden es drei Milliarden sein. Seit der Erfindung des Automobils vor gut 100 Jahren rechnet man mit 70 Millionen Toten, drei Milliarden Verletzten und 200 Millionen Menschen mit bleibenden Behinderungen. Bezieht man die Folgeschäden ein, also die Zahl vorzeitiger Todesfälle durch autobedingte Luftverschmutzung, kommt man weltweit auf 200 bis 230 Millionen Tote. Allein der deutsche Autoverkehr ist durch Reifen- und Asphaltabrieb für 126.000 Tonnen Mikroplastik verantwortlich, der letztlich ins Meer gelangt. „Keine Technik hat je mehr Opfer gefordert“, bilanziert der Autor Klaus Gietinger die Lage.
Die Zahlen sprechen für sich und die Befunde sind tatsächlich alarmierend. „Das Auto führt grundsätzlich Krieg gegen die Menschen, die Umwelt und ein gesundes Klima“ oder „Geld muss (…) den Kfz genommen werden“ – derlei verbiesterte Sätze sprechen für ein verwildertes Denken und ein halbblindes Lektorat.
Gietinger kritisiert zu Recht, wie Politik und Autokonzerne jahrzehntelang die Probleme, die der motorisierte Individualverkehr erzeugt, mit untauglichen Mitteln wie Straßenbau und Straßenausbau zu lösen versuchten. Er bezieht sich dabei auf die verglichen mit der Autolobby eher schwache Stimme autokritischer Organisationen. Aber im Gegensatz zu diesen vertraut der Autor auf wenig überzeugende, rhetorisch-totalisierende Reduktionsformeln und Verallgemeinerungen: „Mobilität ist nur eine Folge der maßlosen Bewegung und Akkumulation des Kapitals.“
Bei der Bestimmung der Ursache für Geschwindigkeit und Beschleunigung wankt der Autor noch hin und her zwischen dem „Beschleunigungsgen im Menschen“, dem „testosterongesteuerten Mann“ und der „Bewegung des Kapitals“.
Mit Panikmache statt Fakten
Alarmstimmung und Panikmache sind für einen Autor nicht die besten Voraussetzungen. Gietinger bedient sich, wo es um die argumentative Durchdringung und Erklärung seiner Befunde ginge, ausgesprochen simpler Psychologismen. Das Auto habe uns zu „Junkies“ gemacht, abhängig vom „Drogenkartell der Autokonzerne“, den „Drogendealern“ in der Regierung, die mit den Konzernen eine „kriminelle Vereinigung“ bildet. Er empfiehlt sogar dem Europäischen Gerichtshof (EUGH), analog zur Kammer für „Kriegsverbrecher“ eine Kammer für Verkehrsverbrecher“ einzurichten und nach 2030 „die letzten noch lebenden Kfz-Verkehrsminister (…) wegen bedingt vorsätzlichem massenhaften Totschlags“ anzuklagen. Mit solcher Rhetorik macht Gietinger seine lesenswerte Kritik zum Beispiel an Scheinalternativen wie dem Elektroauto oder „klimaneutralen Kraftstoffen“ unglaubwürdig. Der automobile Wahnsinn hat einen besseren Kritiker verdient.