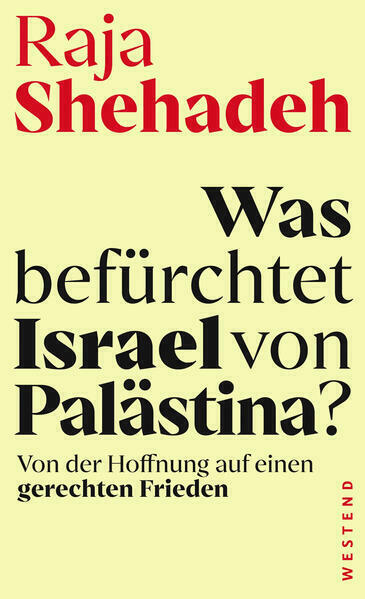Was den Israelis gelang und den Palästinensern misslang
Tessa Szyszkowitz in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 30)
Zum Jahrestag des 7. Oktober sind in den deutschsprachigen Verlagshäusern einige Bücher von israelischen Autorinnen und Autoren erschienen – siehe etwa Lee Yarons „Israel, 7. Oktober“ oder das von Gisela Dachs herausgegebene „7. Oktober. Stimmen aus Israel“ (rezensiert im Falter 40). Wenig ist aber über den Krieg und seine Folgen für Palästinenserinnen und Palästinenser publiziert worden. Eine Ausnahme ist der Essayband des palästinensischen Schriftstellers Raja Shehadeh. Der 73-jährige Autor und Rechtsanwalt aus Ramallah gehört zu den feinen Denkern des Nahen Ostens und zählt seit Jahren zum Kreis der Autorinnen und Autoren der New York Review of Books.
Raja Shehadeh hat sein ganzes Leben mit der Nakbah verbracht. Nakbah – Katastrophe auf Arabisch. So nennen die Palästinenser, was ihnen bei der Gründung Israels widerfahren ist. Nach 1948 stellten die Palästinenser erstaunt fest, dass das junge Israel auf dem Boden Palästinas wirklich entstand. Zu ihrer Überraschung tat niemand etwas dagegen. 700.000 palästinensische Araber verloren ihre Heimat. Manche, wie die Familie von Raja Shehadeh, flohen aus der Küstenstadt Jaffa ins Hügelland des Westjordanlandes. Es stand unter der Kontrolle Jordaniens. „Der Verlust ihres Landes im Jahr 1948 war ein Schock für die Palästinenser und führte zu jahrzehntelanger Verzweiflung“, schreibt Raja Shehadeh.
Und dann passierte es 1967 wieder. Israel wurde von den arabischen Nachbarn angegriffen, drehte den Kriegsverlauf um und besetzte im sogenannten Sechstagekrieg das Westjordanland und den Gazastreifen. „Wir konnten uns nicht vorstellen, dass Israel mit der Ansiedlung von 750.000 Siedlern in unserer Mitte im Westjordanland und in Ostjerusalem durchkommen würde.“ Doch so ist es geschehen. Seit Jahrzehnten breiten sich die israelischen Siedlungen aus.
In seinem Essay „Permission to Narrate“ hatte der palästinensische Gelehrte Edward Said schon 1984 festgestellt, dass sich daran nichts änderte, obwohl die Palästinenser durch das internationale Recht unterstützt wurden. Die Besetzung der Westbank gilt bis heute als illegal. Raja Shehadeh gesteht sich bitter ein: „Trotz all unserer Versuche, über die Situation zu schreiben, scheinen wir Palästinenser nichts an der Art und Weise geändert zu haben, wie diese Ereignisse von den Israelis und der Außenwelt wahrgenommen werden.“
Der palästinensische Schriftsteller Raja Shehadeh erzählt, wie seine Großmutter ihm abends von Ramallah aus immer wieder die Lichter von Jaffa zeigte, der verlorenen Stadt am Meer. Der kleine Enkel, der ehrfürchtig den Erzählungen der Erwachsenen gelauscht hatte, wuchs zu einem jungen Mann heran. 1967 fuhr er nach Jaffa, denn nachdem Israel das Westjordanland erobert hatte, waren Ramallah und Jaffa wieder im gleichen Land: Israel. Was Shehadeh aber zu seiner Überraschung feststellte: Die Lichter, die seine Großmutter für die von Jaffa gehalten hatte, waren in Wirklichkeit jene von Tel Aviv. Jaffa lag verlassen im Dunkeln. Tel Aviv aber war die Metropole eines neuen Staates, eine Stadt unter Strom. Heute ist die alte palästinensische Stadt eine Art trendiger Vorbezirk von Tel Aviv geworden. Palästinensische und jüdische Israelis leben hier mehr oder weniger freiwillig zusammen.
Was den Israelis gelang, misslang den Palästinensern. Ein eigener Staat blieb Wunschtraum. Die palästinensische Führung verabsäumte es, dem stärker werdenden Israel etwas entgegenzusetzen. Dazu kam, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu auf Umwegen die Hamas-Regierung im Gazastreifen stärkte, um die von Jassir Arafats Fatah dominierte Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland zu schwächen. Ab 2018 erlaubte Netanjahu dem Emirat Katar, monatlich 15 Millionen Dollar in bar an die Hamas im Gazastreifen abzuliefern. „Die Hamas nutzte einen Teil dieser Gelder“, vermerkt Raja Shehadeh, „um für den gegenwärtigen Krieg mit Israel zu trainieren.“
Im zweiten Essay des Bandes befasst sich der Autor mit dem Krieg im Gazastreifen. Den Angriff der Hamas am 7. Oktober kritisiert Shehadeh: „Während eine besetzte Bevölkerung nach dem Völkerrecht zwar das Recht hat, Widerstand zu leisten, hat sie nicht das Recht, Kriegsverbrechen zu begehen.“ Die Antwort Israels auf das Massaker und die Geiselnahme von etwa 250 Menschen ist ein Krieg, dessen Ausmaß alles Bisherige bei weitem übersteigt. Über 40.000 Tote, 80.000 Verwundete, 80 Prozent der 2,3 Millionen Palästinenser in Gaza intern vertrieben, 90 Prozent der Kinder unter fünf Jahren leiden an akuter Ernährungsarmut. 70 Prozent der zivilen Einrichtungen und der Infrastruktur sind zerstört. „Dieser Krieg ist bei weitem der verheerendste, den Israel jemals geführt hat.“ Shehadeh kommt zu dem Schluss, dass Israel nicht nur die Hamas vernichten will. „Aufgrund des grausamen Verhaltens der Hamas wurde das gesamte palästinensische Volk verurteilt und hat in den Augen vieler Israelis sein Existenzrecht verloren.“
Der Autor beschreibt nicht nur die Auswirkungen des 7. Oktober und des Krieges auf die Zivilbevölkerung von Gaza – auch im Westjordanland und in Ostjerusalem hat die Gewalt zugenommen. „Laut Ha’aretz besteht das neue Protokoll für die Festnahme von gesuchten Personen darin, das Haus einzukreisen, den Verdächtigen aufzufordern, das Gebäude zu verlassen und – falls er nicht herauskommt – eine Panzerabwehrrakete auf das Gebäude zu schießen.“
Der Eskalation von Gewalt versucht Shehadeh gegen Ende des Essays eine kleine Hoffnung entgegenzusetzen: die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes, alles zu unterlassen, was genozidalen Handlungen gleichkommen könnte. Der palästinensische Intellektuelle hofft, dass „dieser Triumph des Völkerrechts“ langfristige Folgen für Israels Kontrolle über die Palästinenser haben könnte.
An einem anderen Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag war Shehadeh selbst beteiligt: „Im Juli 2004 urteilte das Gericht, dass die Trennmauer im Westjordanland gegen das Völkerrecht verstößt und abgebaut werden muss.“ Die Mauer steht bis heute. Doch Shehadeh hofft darauf, dass sich Israel auf Dauer den Urteilen der internationalen Gerichtsbarkeit nicht entziehen wird können.
Er warnt auch davor, die Palästinensische Autonomiebehörde wieder beleben zu wollen. „Die PA ist ein Geschöpf des gescheiterten Osloer Abkommens mit vielen eingebauten Beschränkungen.“ Es sei kontraproduktiv, zu dieser Form der Selbstverwaltung zurückzukehren, „die das Gedeihen der Siedlungen ermöglichte“. Bei der palästinensischen Bevölkerung würde eine solche Vertretung in freien Wahlen kaum erfolgreich sein können. Er plädiert für die Abhaltung von Wahlen nach einer Reorganisation der PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation, damit ein Gremium gewählt werden kann, „das alle palästinensischen politischen Gruppierungen vertritt“.
Shehadeh vergisst nicht, die Frage zu beantworten, die er im Titel gestellt hat: „Was befürchtet Israel von Palästina?“ Die resignierte Antwort: „Die Existenz Palästinas selbst.“ Er konstatiert, dass die messianistische Rechte in Israel und die zersplitterte politische Führung der Palästinenser eine Lösung des Konflikts extrem erschweren. Unter Einbindung der USA, der UNO und des Globalen Südens aber könnte der Druck auf die Streitparteien erhöht werden, um ein Abkommen zu erreichen.
Zum Schluss kommt er, wie so oft, auf seinen Vater Aziz zurück. Der moderate Politiker und Rechtsanwalt hatte schon 1967 vorgeschlagen, einen Staat Palästina neben Israel zu gründen. Man schenkte ihm kein Gehör. 1985 wurde er ermordet. Heute aber, hofft sein Sohn Raja, „gibt es einen Konsens, dass es nur dann Frieden in der Region geben wird, wenn ein palästinensischer Staat gegründet wird“.