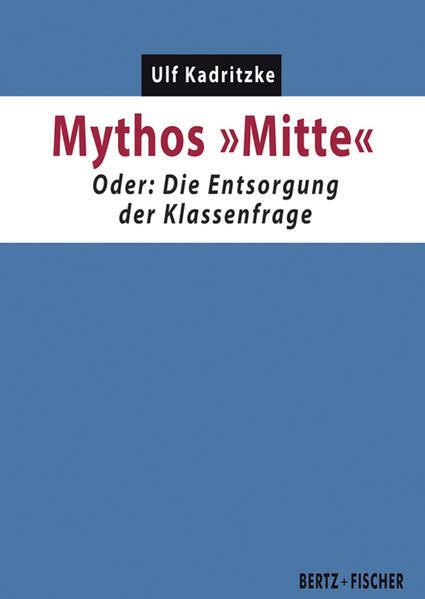Die Mitte – ein Mythos?
Erich Ederer in FALTER 40/2017 vom 04.10.2017 (S. 61)
Ulf Kadritzke betrachtet die Rede von der Mitte als Entsorgung der Klassenfrage
Die zunehmende Ungleichheit in der Gesellschaft und die sich ausbreitende Verunsicherung haben den Blick der Sozialwissenschaft in den vergangenen Jahren verstärkt auf die Mittelschicht gelenkt.
Die Sorge wegen ihrer Erosion und der Folgen für die Stabilität des gegenwärtigen Systems bestimmt aber auch die öffentliche Diskussion. Für den deutschen Soziologen Ulf Kadritzke ist diese „Mitte“ allerdings ein Mythos und der auf sie fixierte Blick eine Folge der „Entsorgung der Klassenfrage“ – so auch der Untertitel seines 2017 erschienenen Buches.
Er unternimmt einen Rückblick auf die Weimarer Soziologie der Zwischenkriegszeit und versucht zu zeigen, dass die gegenwärtige Forschung dahinter zurückfällt.
Nach dem Ersten Weltkrieg nahm die Gruppe der Angestellten stark zu. Dieser „neue Mittelstand“ sah sich schon damals eher den Handwerkern, Händlern und Gewerbetreibenden nahe als dem Proletariat. Die Soziologen Theodor Geiger, Siegfried Kracauer und Hans Speier stellten jedoch die Einheit dieser „Zwischenklasse“ infrage und unterstrichen die Lohnabhängigkeit der Angestellten.
Sie betonten allerdings auch die innere Differenzierung der Arbeiterklasse, die aus der Vielfalt der Lohnarbeitsformen hervorging. Die Weimarer Soziologie bezog damit eine Position zwischen der marxistisch orientierten Sozialforschung und der von ihr kritisierten „neuen Mittelstandsideologie“.
Die gegenwärtige Sozialwissenschaft werfe nun mit ihrer Fixierung auf die Mittelschicht die Klassentheorie über Bord, so Kadritzke. Dies verdecke die Einkommensentstehung und damit die unterschiedlichen Interessen von Arbeit und Kapital.
Der „Mitte“ komme dabei eine ideologische Funktion zu: Sie gilt als leistungswillig und ist sowohl Stütze als auch Motor der Gesellschaft. (Ein gewisses Maß an) Ungleichheit werde dadurch legitimiert und die kapitalistische Produktionsweise als ihre Ursache ausgeblendet. Die bestehenden Verhältnisse werden somit nicht mehr infrage gestellt, und die politische Diskussion verschiebt sich hin zur „sozialstaatlichen Einhegung“ von Ungleichheit. Kadritzke wirft der gegenwärtigen Soziologie damit vor, mittels „inszenierter Mittelschichtspanik“ zur Bewahrung des Systems beizutragen.
Ulf Kadritzke argumentiert daher für die Rückbesinnung auf die Klassentheorie, die im Unterschied zu Schichtungsmodellen von den Produktionsverhältnissen ausgeht. Diese müsse dann durch Differenzierungslinien innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen ergänzt werden. Eine solche Perspektive soll dazu beitragen, widersprüchliche Interessen zu beleuchten und den gemeinsamen Nenner – den Kampf um gerechten Lohn, gute Arbeit und soziale Absicherung – wieder stärker in den Vordergrund zu rücken.