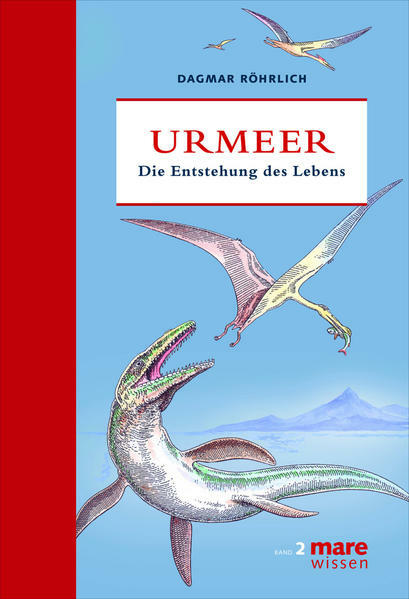Abyss â eine Reise in die Tiefen des Lebens
Peter Iwaniewicz in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 41)
Meeresforschung: Zwei so schöne wie gut erzählte Bücher berichten von den Tiefen der Meere und ihrer Erkundung
Wer sich schon überlegt hat, auf E-Books umzusteigen, wird angesichts dieser beiden Bücher über die Tiefsee und das Leben in ihnen davon Abstand nehmen. Sie verbinden wunderbare Haptik des Einbands, feine Grafiken und Fotos, dezente Schmuckfarben im Text, seidige Lesebändchen und jene betörende Duftmischung aus hochwertigem Papier und Druckerschwärze, die bibliophile Menschen so schätzen. Und auch inhaltlich geht es in die Tiefe.
Während Mitte des 19. Jahrhunderts fast alle Regionen der Welt erkundet und kartografiert waren, blieben die Meere weiterhin unergründlich. So glaubte man, dass unterhalb einer Wassertiefe von etwa 500 Metern kein Leben möglich sei, und hatte so gut wie keine Kenntnis von Vielfalt und Verteilung der Meereslebewesen.
Auf hartnäckiges Betreiben des Zoologen Carl Chun genehmigte Kaiser Wilhelm II. die erste große deutsche Expedition zur Erforschung der Tiefsee. Das Forschungsschiff Valdivia, ein für wissenschaftliche Expeditionen umgerüsteter Dampfer, stach 1898 in See und kehrte nach über 32.000 Seemeilen durch den Atlantik und den Indischen Ozean ein Jahr später nach Hamburg zurück.
Die Ausbeute an unbekannten Tieren und ozeanografischen Erkenntnissen war so groß, dass das letzte Buch des 24-bändigen wissenschaftlichen Berichts erst 1940 erschien.
Andreas von Klewitz erzählt in "Carl Chun, die Valdivia und die Entdeckung der Tiefsee" anhand von Originalzitaten aus der "gemeinverständlichen" Ausgabe diese bemerkenswerte Entdeckungsreise nach. Das gelingt ihm mit feinem Gespür für die Filetstücke eines Textes aus dem 19. Jahrhundert, dessen Stil für heutige Lesegewohnheiten in ungekürzter Originallänge eher ermüdend wirken würde.
Mit Sachverstand begleitet und kommentiert er den Expeditionsbericht Carl Chuns, der neben den bizarren Tieren der Tiefsee auch interessante ethnologische Betrachtungen und kurze Abrisse der Entdeckungsgeschichte der von ihm besuchten Inseln und Landstriche bietet.
Auf diese Weise ermöglicht das Buch neben den eingangs erwähnten ästhetischen Reizen mehrere Rezeptionsebenen: Wege und Irrwege wissenschaftlicher Forschung werden lebendig, man kann sich auch an einem historischen Abenteuerroman erfreuen, und nicht zuletzt rufen manche seltsam anmutenden Ansichten über die indigene Bevölkerung der Inseln die Ära deutscher Kolonialgeschichte in Erinnerung. Hier bekommt man alles, was ein gutes Sachbuch bieten kann.
Ein zweites, optisch fast noch opulenteres Buch darf an dieser Stelle auf keinen Fall fehlen, obwohl es bereits 2012 erschien. "Urmeer" nennt die Geologin und Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhrlich ihr umfangreiches Werk, das laut Untertitel – und nicht ganz unbescheiden – "Die Entstehung des Lebens" auf unserem Planeten abhandelt.
An einer solch herkulischen Aufgabe kann man leicht scheitern. Entweder langweilt man seine Leser mit endlosen und hypothetischen Beschreibungen der ersten Einzeller, oder man muss sich an preisgekrönten Büchern wie Richard Forteys "Leben – Eine Biografie. Die ersten vier Milliarden Jahre" (1999) messen lassen.
Röhrlich meistert diese Herausforderung, indem sie textbegleitende Fakten in Infokästen auslagert, es versteht, in exzellenten Illustrationen die Sachverhalte verständlich zu machen, und nicht zuletzt, indem sie einen erzählerischen roten Faden in Gestalt des dänischen Naturforschers Nicolaus Steno anbietet.
Dieser Arzt, Anatom und Naturforscher war im 17. Jahrhundert einer der wesentlichen Begründer der Geologie, jener Wissenschaft, die als erste die Zeitangaben der Bibel über das Alter unserer Welt anzuzweifeln wagte.
Immer wieder kehrt die Autorin nach Exkursen über das Leben in den archaischen Ozeanen, Problemen der Altersbestimmung und der Entstehung sexueller Fortpflanzung zu ihrem historischen Protagonisten und seinem bewegten Leben zurück. Anhand seiner Person zeigt sie die Probleme wissenschaftlicher Erkenntnis und die Entstehung von gesellschaftlich akzeptierten Tatsachen auf.
Stilistisch elegant verbindet sie fundiertes Sachwissen mit menschlichen Dramen, Forschungsergebnisse mit Sagengeschichten und weist auf aktuelle Probleme wie Artensterben und Meeresverschmutzung hin.
Oft werden angloamerikanische Sachbuchautoren für ihren lockeren und kundigen Erzählstil gelobt, Dagmar Röhrlich zeigt mit diesem Werk, dass dies auch im deutschen Sprachraum möglich ist.