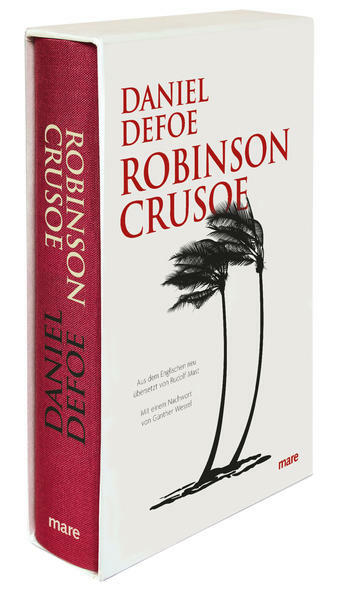Auf den Weltmeeren der Weltliteratur
Klaus Nüchtern in FALTER 48/2019 vom 27.11.2019 (S. 33)
Daniel Defoes „Robinson Crusoe“ wurde zum Jugendbuch zurechtgestutzt, ist aber viel mehr als ein Abenteuerroman
Jetzt ist es auch schon wieder 300 Jahre her, seitdem „The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner“ erschienen ist. Und kaum ein Werk der Weltliteratur kann auf eine derartige Wirkungsgeschichte zurückblicken. Das Buch hat seinen Verfasser, Daniel Defoe, nicht reich, aber berühmt gemacht, bloß dass es seinen Erfolg nicht unbedingt dem verdankt, was der Autor ursprünglich geschrieben hatte.
Nicht nur der Titel wurde auf „Robinson Crusoe“ eingedampft, sondern der ganze Roman für die Bedürfnisse und Lesegewohnheiten eines Zielpublikums zurechtgeschustert, das ihm abseits der Intentionen des Autors zugewachsen war. Erheblichen Anteil daran hat der deutsche Schriftsteller und Pädagoge Joachim Heinrich Campe, ein Pionier der Kinder- und Jugendbuchliteratur, der 1779/80 eine der bekanntesten „Übersetzungen“ ins Deutsche besorgte und befand, „dass so viel weitschweifiges, überflüssiges Gewäsche, womit dieser veraltete Roman überladen ist, die bis zum Ekel gezerrte, schwerfällige Schreibart desselben und so manche, in Rücksicht auf Kinder, fehlerhafte moralische Seite desselben, keine wünschenswerte Eigenschaft eines guten Kinderbuches sind“.
Defoes Roman liefert die Blaupause aller Schiffbrüchigengeschichten und diese ist es auch, die man mit dem Namen „Robinson Crusoe“ verbindet. Dass ein knappes Viertel des Buches gar nicht auf der Insel spielt, auf der der nun nicht mehr wirklich junge Mann aus York „achtundzwanzig Jahre, zwei Monate und neunzehn Tage verbracht hatte“, gehört zu den Überraschungen, die einen bei der Wiederbegegnung mit diesem erwarten.
Ganz unrecht hatte Campe ja nicht: Im Vergleich mit den Actionszenen – Sturm, Schiffbruch, Rettung in letzter Not; die Befreiung Freitags, der Kampf mit Kannibalen und meuternden Matrosen – nehmen sich die Beschreibungen des Inselalltags, die Geschichte von der Wiedergewinnung des eigenen Vermögens nach der Rückkehr und vor allem die erbaulichen Passagen, in denen Crusoe vom religiösen Analphabeten zu einem demütigen Christenmenschen heranreift, der später auch missionarisch tätig werden kann, in der Tat etwas weitschweifig aus.
Am Anfang aber stehen jugendliches Ungestüm und unbändige Abenteuerlust. Der Vater empfiehlt seinem Jüngsten die Tugenden und Freuden des mittleren Standes und rät zu Besonnenheit, Mäßigung und Gelassenheit. Der junge Mann zeigt sich von den Reden des Vaters „tief beeindruckt“ und würde diesem auch gerne willfahren, indes: Es hält ihn nicht, er muss zur See, und selbst ein Sturm an der heimischen Küste, den er nur mit knapper Not überlebt, und die eindringliche Warnung des Kapitäns, diese Zeichen der Vorsehung ernst zu nehmen, sind nicht in der Lage, Robinson von seinem Entschluss abzubringen.
Der Abenteuerroman „Robinson Crusoe“ hat auch seine sinistren Seiten. An Bord eines „Guineafahrers“ kommt der Held zu erstem bescheidenem Reichtum; er gerät in die Hände türkischer Piraten und schließlich als Sklave in den Besitz eines maurischen Kaufmanns. Nach seiner Flucht entlang der afrikanischen Küste, wo er auf Löwen und Tiger (!) ballert, segelt er nach Brasilien und steigt als erfolgreicher Plantagenbesitzer in ein äußerst lukratives Geschäft ein, das „seinerzeit noch in den Kinderschuhen steckte“. Bekannten erzählt er gerne, „wie leicht es war, an der Küste Petitessen wie Glasperlen, Spielzeug, Messer, Scheren, Beile Glas und dergleichen mehr gegen Goldstaub, Guineapfeffer, Stoßzähne von Elefanten und anderes, vor allem aber gegen Schwarze in großer Menge einzutauschen, die in Brasilien gebraucht wurden“.
Der transatlantische Sklavenhandel bildet die Grundlage von Robinson Crusoes Reichtum. Man könnte die Jahre auf der Insel, während der er sich mühsam von eigener Hände Arbeit ernähren muss und als Jäger, Sammler, mit Ackerbau und Viehzucht die Anfänge der Menschheitsgeschichte noch einmal nachholen muss, als Sühne für diesen Sündenfall betrachten.
Dass dies vom Autor so gedacht war, ist freilich anzuzweifeln. Christliche Demut hindert Robinson zwar daran, seine Tötungsfantasien gegenüber den Kannibalen aus schierer Empörung über deren barbarisches Wesen in die Tat umzusetzen – ständig wird im Roman über legitime Gründe des Tötens räsoniert –, aber die koloniale Arroganz sitzt tief. Selbstverständlich betrachtet der Mann aus York die Gestade, an denen er gestrandet ist, als seinen Besitz, über den er als „uneingeschränkter Gebieter und Gesetzgeber“ herrscht: „Auffallend war auch, dass ich nur drei Untertanen hatte, die alle unterschiedlichen Religionen angehörten: Mein Freund Freitag war Protestant, sein Vater Heide und Kannibale und der Spanier Katholik. Aber in meinem Reich gewährte ich Glaubensfreiheit.“ Immerhin.
Zu Lebzeiten Defoes hatte der Völkermord an den nordamerikanischen Ureinwohnern bereits begonnen. Wenn in „Robinson Crusoe“ „das grausame Gebaren der Spanier in Amerika“ gegeißelt und festgehalten wird, dass diese Gräuel „heute von den Spaniern selbst, erst recht von den anderen christlichen Nationen Europas, (…)als blutiges Abschlachten und widernatürliche Grausamkeit empfunden“ wird, klingt das auch ein bisschen bigott. Aber um die Lernfähigkeit des Menschen ist es wohl ohnedies nicht allzu gut bestellt. Als reicher Mann nach England zurückgekehrt, erzieht Robinson einen seiner beiden Neffen „zu einem Ehrenmann“, dem jüngeren aber „verschaffte ich ein gutes Schiff und schickte ihn zur See“.