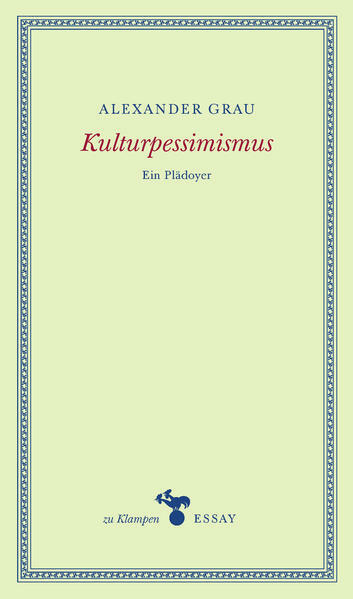Ist die Kultur also wirklich schon tot?
Florian Baranyi in FALTER 41/2018 vom 10.10.2018 (S. 38)
Kulturtheorie: Hannelore Schlaffer und Alexander Grau verabschieden Intellektuelle und Hochkultur
Die Essayreihe des Verlages zu Klampen hat zwei Neuzugänge, die mit ihren Thesen verwundern. Dabei handelt es sich um die zugespitzte Kulturgeschichte des Intellektuellen der Germanistin Hannelore Schlaffer und um ein Plädoyer für den Kulturpessimismus des Journalisten Alexander Grau. Beide Bände sind von einem erschütternd verengten Konservativismus geprägt, der beide Male eine verklärende Idealisierung des Abgelebten schon auf den ersten Seiten in Szene setzt.
Bei Schlaffer liest man, der Intellektuelle, dessen „Grabrede“ sie verfassen möchte, existiere nicht mehr: „Wo auf der Straße der Mann mit der Zeitung unter dem Arm fehlt, gibt es keinen Intellektuellen mehr.“ Grau macht gleich im ersten Satz seines an Setzungen nicht armen Bändchens klar: „Der Kulturpessimismus ist tot.“ Um diese Behauptungen zu plausibilisieren, bedarf es mehr oder weniger gefinkelter methodischer Twists.
Hannelore Schlaffer, selbst Intellektuelle mit 15 eigenständigen Buchpublikationen, begreift den Intellektuellen als ästhetisches und strukturelles Phänomen. Folgerichtig versteht sie die Inkarnation der „freischwebenden Intelligenz“ – ein Schlagwort, das Schlaffer dem Soziologen Karl Mannheim entlehnt – als über ihr provokatives und Regeln überschreitendes Verhalten definiert und nicht, wie man annehmen möchte, durch Bildung oder Profession. Sie sieht den Intellektuellen, wie schon der Untertitel ihrer „Erfolgsgeschichte“ lautet, als „Rüpel und Rebell“. Dass das eine moralische und das andere eine politische Vokabel ist, lässt auf die Verbindung der beiden Dimensionen hoffen. Diese Hoffnung wird von Schlaffer aber systematisch unterlaufen. Ihr Fokus liegt deutlich auf der gesellschaftlichen Transgression, der Provokation, der Rüpelhaftigkeit. Sie beginnt ihre Genealogie des Intellektuellen mit Diderots „Rameaus Neffe“, einer ungehobelten und höchst erfolgreichen Romanfigur, die lebensnah nach Jean Jacques Rousseau modelliert wurde. Schlaffer gibt sich alle Mühe, Rousseaus Erfolg durch dessen unkonventionelles Auftreten im Frankreich der Aufklärung zu deuten und ihn damit in die Tradition des Zynikers Diogenes zu stellen.
Freilich nannte das ausgehende 18. Jahrhundert seine Intellektuellen noch „philosophes“. Deren Translation in den deutschen Sprachraum zeichnet Schlaffer anhand von Goethes Übersetzung von „Rameaus Neffe“ nach. Der Dichterfürst gefiel sich in seiner Sturm-und-Drang-Phase wohl selbst als Enfant terrible, wie Schlaffer kundig ausführt. Goethe reiht sich bei ihr genauso in die Ahnengalerie der Intellektuellen ein wie die nonkonformistischen deutschen Studenten der Romantik, die französischen Bohemiens und der britische Ur-Dandy George Brummell.
Schlaffer beschreibt zwar in ihrem Vorwort die Entstehung des Intellektuellen im Wortsinn aus der Affäre Dreyfuss 1898 und der von Émile Zola angestoßenen Empörung, die als „Manifeste des intellectuels“ in die Geschichte einging. In den Analysen spielt das späte 19. Jahrhundert genauso wie fast das gesamte 20. Jahrhundert keine Rolle mehr. Diese methodische Leerstelle, die die Figur des „public intellectual“ unter den Tisch fallen lässt, gesellt sich zu einer noch gewichtigeren Ellipse.
Frauen erscheinen bei Schlaffer nie als Intellektuelle, sondern lediglich als deren struktureller Gegenpart in Form von Salondamen, Mätressen und Schauspielerinnen. Das mag tatsächlich emanzipatorisch gemeint sein, Schlaffer beschreibt die Ausweitung weiblicher Handlungsspielräume aber immer in Bezug auf deren moralische Bewertung durch (bürgerliche) Männer und unter Subtraktion ihrer geistigen – also im Wortsinn intellektuellen – Leistungen. Diese verquere Deutung gipfelt in der – aus den Tagebüchern der gehässigen Brüder Goncourt extrapolierten – Behauptung, die Emanzipation verdanke ihren Erfolg der „Abneigung des Mannes gegen die Verantwortung für die Familie“.
Alexander Grau, der 2017 die Streitschrift „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ vorlegte, versteigt sich in seiner Rehabilitierung des Kulturpessimismus in ähnlich revisionistische Thesen. Er definiert Kultur, anders als der kulturwissenschaftliche Mainstream, als ein Setting von zwar veränderlichen, aber doch immer ausschließenden und Normen institutionalisierenden Handlungen und Codes. Ein solch enges und exklusives Kulturverständnis begegnete dem Rezensenten das letzte Mal in José Antonio Maravalls Standardwerk „Die Kultur des Barock“ (1975).
Graus Ansicht ist aber noch weitaus radikaler: Durch den Verlust einer verbindlichen kulturellen Norm einerseits und die hedonistischen und pluralistischen Auswüchse des modernen Massenwohlstandes andererseits seien wir in die Phase der Postkultur eingetreten. Dabei ergeht sich Grau in lehrbuchhaften Zirkelschlüssen. Aus seiner Setzung, Kultur sei stets normierend und exklusiv, folgert er: „Aufgrund der spezifischen Verfasstheit von Kultur ist es ein Irrglaube anzunehmen, Kultur sei mit einer zivilisierten, humanen, sozialen Wohlstandsgesellschaft vereinbar.“
Der ganze Traktat ist durchwirkt von beißendem Ressentiment. Woher die Kränkungen rühren, die unsere hedonistische und plurale Gesellschaft dem streitbaren Philosophen derart zugefügt hat, dass er uns implizit qua Kulturverlust zu, nun ja, Barbaren stilisieren muss, wird nicht recht plastisch. Am Ende bleibt, was zu beweisen war, der Kulturpessimismus als „letzte Möglichkeit, die Würde des Menschen zu wahren“. In unserer Nachkultur wäre der Kulturpessimismus aber auch nichts anderes als rückwärtsgewandte Trauerarbeit.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: