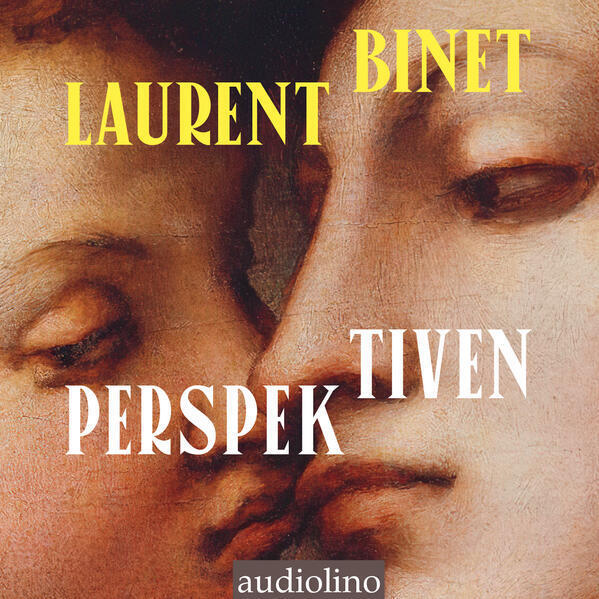Verlogene Briefe, gemeuchelte Maler
Thomas Leitner in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 6)
Am 1. Jänner 1557 wurde Jacopo da Pontormo tot aufgefunden. Der Maler lag erstochen unter dem Freskenzyklus im Chor der Basilika von San Lorenzo in Florenz. Der von Kunsthistorikern als der „gespreizteste der Manieristen“ Bezeichnete arbeitete seit elf Jahren an diesem Werk, wollte es hier mit Michelangelos „Jüngstem Gericht“ aufnehmen. Das erfährt der Leser aus dem ersten von 176 Briefen, erstanden von einem Reisenden als antiquarisches Konvolut in Arezzo, der Mordfall in der Künstlerszene wird in ihnen aufgerollt werden.
Laurent Binet, Jahrgang 1972, bedient sich also der klassischen Herausgeberfiktion – der belehrende Ton des „Übersetzers“ im Vorwort lässt unschwer Stendhal und dessen „Italienische Chroniken“ als Vorbild erkennen.
In seinem historischen Kriminal- und Briefroman „Perspektiven“ bleibt Binet bei seinem angestammten Thema; die Spannung zwischen Wirklichkeit und literarischer Erfindung beschäftigt ihn seit dem ersten literarischen Erfolg „HHhH“ (für: „Himmlers Hirn heißt Heydrich“). Dort behandelte er noch vorsichtig reflektierend das Recht des Autors, fiktional einzugreifen – wohl auch, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, mit Nazigräueln Effekte zu produzieren.
Im Linguistenroman „Die siebente Sprachfunktion“ wurde er schon schneidiger und ließ den poststrukturalistischen Intellektuellen Roland Barthes brutal meucheln, und in „Eroberung“ schließlich, Vorgänger des aktuellen Buchs, seine Fantasie frei schweifen: Kolumbus kommt nicht bis Amerika, dafür erobern die Inkas das Reich Karls V., Atahualpa setzt den Kaiser gefangen.
Auch in „Perspektiven“ bildet die Geopolitik des 16. Jahrhunderts den Rahmen: Frankreichs und Habsburgs Kampf um Italien machen urbane Zentren wie Florenz zum Spielball der Großmächte, der neue toskanische Herrscher Cosimo versucht mitzumischen, getrieben vom ehrgeizigen Ziel, selbst eine Königskrone zu erlangen. Der alte Hegemonialstreit zwischen Kaiser und Kirche schwelt weiter, und Paul IV. ist als Papst ein besonders liebenswertes Exempel: Kunstfeind, Antisemit und Initiator des Index verbotener Bücher.
Doch nicht nur pontifikaler Absolutismus bedroht die profane Kultur, im Untergrund, vor allem in den Klöstern, wirkt das fanatische Erbe des Dominikaners und Kirchenreformators Girolamo Savonarolas fort. Dies alles kommt im ausgebreiteten Briefverkehr detailreich und lebendig zum Ausdruck, an dem Angehörige aller Gesellschaftsschichten beteiligt sind.
Das reicht vom zunftlosen, klassenkämpferischen Farbenmischer (dessen pseudomarxistischer Jargon allerdings doch zu anachronistisch scheint) bis zu den Spitzen der Gesellschaft, also Cosimo selbst und seiner verfeindeten Cousine Catherine de Médicis, Königin von Frankreich. Ein amouröser Nebenstrang wird im Stil von Choderlos de Laclos’ „Gefährlichen Liebschaften“ abgehandelt.
Binet beleuchtet die Konkurrenz und Intrigen unter Künstlern: Der Herzog beauftragt Giorgio Vasari mit der Aufklärung des Mordes, dem ein Gegenspieler in der Person Benvenuto Cellinis erwächst. Für unterschiedliche Perspektiven ist also gesorgt. Zwar gilt der eine als Begründer der Kunstgeschichtsschreibung, ist aber wegen seiner einseitigen Wertungen umstritten. Cellini hingegen war ein großer Bildhauer, Kupferschmied und Literat, als Mensch aber wohl ein dubioser Zeitgenosse.
Ein zur Tatzeit in Florenz Anwesender muss es gewesen sein: einer der Manieristen! Die Vertreter dieser Stilrichtung, die der Trinität Leonardo/Raffael/Michelangelo nachfolgten, litten unter dem übermächtigen Erbe. Nur ein Bruch versprach Befreiung und Weiterentwicklung. Man versuchte es also mit artistischer Willkür und rätselhaften Sujets in der Darstellung. Wie schon der austro-britische Kunsthistoriker Ernst Gombrich zieht auch Laurent Binet Parallelen zur Moderne. Sein Roman lässt aber auch die manieristische Wende nicht außer Acht, die Michelangelo selbst in seinem Spätwerk vollzogen hat, weswegen der greise Künstler im Romangeschehen auch eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
Der Autor treibt ein elegantes Spiel auf vielerlei Ebenen. Er liefert eine geraffte Geschichte der Renaissance, die der Leser mit Gewinn als Führer durchs historische Florenz zur Hand nehmen kann. Einen zusätzlichen Reiz erfährt der Krimiplot durch den Umstand, dass es sich bei den Verfassern der Briefe, in denen er enthüllt wird, um mehr oder weniger unverlässliche Erzähler handelt.