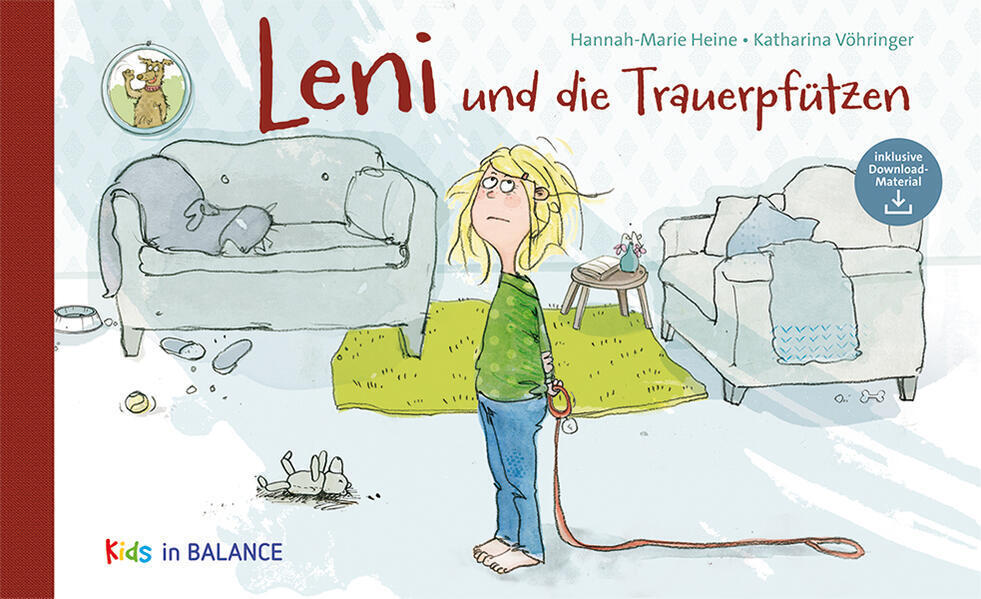"Der Oma macht das nichts mehr"
Sara Schausberger in FALTER 44/2025 vom 29.10.2025 (S. 34)
Die Urne wiegt schwer in der Hand. Sie rasselt, wenn die Kinder sie schütteln. Wer hätte erwartet, dass Asche so grobkörnig ist? Die Innsbrucker Bestatterin und Autorin Christine Pernlochner-Kügler hat zur Buchpräsentation ihres Kinderbuchs "Der Club der kalten Hände" im Wiener Buchkontor eine gefüllte Urne mitgebracht. Was von der Feuerbestattung übrig bleibt, seien keine feinen Flocken, sondern ein Granulat aus Knochen, erklärt sie im Gespräch nach der Lesung.
Pernlochner-Kügler arbeitet regelmäßig mit Kindern und lädt sie auch in ihr Bestattungsinstitut in Innsbruck ein. Nun hat sie ihr erstes Kinderbuch geschrieben. Es handelt von Lizzy und deren Bande, die das Bestattungsunternehmen von Lizzys Eltern genauer unter die Lupe nehmen.
"Der Club der kalten Hände" eignet sich für Kinder ab acht Jahren. Die Geschichte berührt und klärt über das Thema Tod auf, gleichzeitig fehlt es nicht an Humor. Die Bande "Der Club der kalten Hände" beobachtet etwa, wie die Hinterbliebenen von Tante Traudl zum Abschied am offenen Sarg Eierlikör trinken.
Aber die Kinder schauen auch zu, wie Onkel Ali von seinen Angehörigen gewaschen wird und trauernde Eltern ihr Baby zur Verabschiedung ein letztes Mal im Kinderwagen schieben. Für die Geschichten im Buch hat die Autorin aus ihrem Berufsalltag geschöpft.
Im Interview mit dem Falter erzählt Pernlochner-Kügler, wann Tote geschminkt werden, was am offenen Sarg erlaubt ist und wie man am besten mit Kindern über das Sterben spricht.
Falter: Frau Pernlochner-Kügler, warum sind Sie Bestatterin geworden?
Christine Pernlochner-Kügler: Ich bin Quereinsteigerin. Ursprünglich habe ich Philosophie und Psychologie studiert und zukünftige Pfleger und Hebammen unterrichtet. In meiner Dissertation ging es um den Umgang mit Scham und Ekel in der Pflege. Auch das Abschiednehmen von Verstorbenen war ein wichtiges Thema. Da geht es viel um Notfalls-und Krisenintervention. Für diese Dinge habe ich mich interessiert und so bin ich in die Bestattungsbranche hineingeschlittert. Da hat es mir gefallen und ich bin geblieben. 2012 habe ich das alteingesessene Innsbrucker Bestattungsunternehmen Josef Neumeier übernommen.
Bestatter ist wahrscheinlich ein nicht so begehrter Beruf.
Pernlochner-Kügler: Zu uns kommen viele interessierte junge Leute, vor allem Mädchen, die ein Praktikum machen wollen. Ich kann die gar nicht alle nehmen und schaue dann immer, was ihre Motivation ist. Viele haben die Vorstellung, dass man bei uns den ganzen Tag Leichen schminkt. Das ist nicht der Fall. In der Ausbildung gab es zwar einen Kurs, der hieß "The Perfect Finish", aber wir schminken nur Verstorbene, wenn es auch im Leben für die Person wichtig war, nie ohne Make-up aus dem Haus zu gehen. Ansonsten verfremdet Schminke zu sehr. Wenn Bewerberinnen die Realität erleben, zeigt sich schnell, wer für den Beruf geeignet ist und wer nicht.
Und wer ist dafür geeignet?
Pernlochner-Kügler: Jemand, der die Konfrontation mit der mitunter harten Realität des Todes aushält: durch Krankheit gezeichnete Körper, Entstellung, Verwesung. Das alles mit teils starken Gerüchen. Auch mit dem Zeitdruck, unter dem man Zeremonien vorbereiten muss, den Nachtschichten und Wochenenddiensten sowie den fordernden Angehörigen kommen nicht alle zurecht. Oder dass viel Büroarbeit und Bürokratie dazugehört. Bestatterin ist kein besonders spiritueller Beruf, wie manche meinen.
Soll man Kinder zu Beerdigungen mitnehmen?
Pernlochner-Kügler: Viele Erwachsene wollen Kinder aus einem falschen Schutzverständnis heraus nicht dabei haben. Aber es hat sich schon einiges zum Besseren verändert. Kinder werden heute mehr eingebunden als noch vor 20 Jahren, als ich in dem Beruf angefangen habe. Man sollte sie immer mitnehmen und von diesen Abschieden nicht ausschließen.
Darum geht es auch in Ihrem Buch: Lizzys Eltern betreiben ein Bestattungsunternehmen, halten das aber vor ihr geheim. Ist das realistisch?
Pernlochner-Kügler: Die Geschichte hat einen wahren Hintergrund. Ich hatte einen Kollegen, der seiner Tochter nicht erzählt hat, dass er als Bestatter arbeitet. Das Mädel dachte lange Zeit, er betreibt ein Transportunternehmen und ist irgendwann draufgekommen, dass das nicht stimmt. Wenn Erwachsene miteinander reden, schnappen Kinder das ein oder andere auf und stellen Fragen. Man kann vor ihnen eh nichts verheimlichen. Kinder sind neugierig.
Wie spricht man denn am besten mit Kindern über den Tod?
Pernlochner-Kügler: Der Tod gehört zum Leben dazu. Bei uns im Bestattungsunternehmen binden wir die Kinder von Anfang an ein: Das beginnt damit, dass es bei der Verabschiedung am offenen Sarg keine Altersgrenze nach unten gibt. Ich kann ein Baby genauso mitnehmen wie einen Drei-oder Vierjährigen.
Wie viel begreifen Kinder davon?
Pernlochner-Kügler: Sie verstehen so viel, wie sie verstehen können. Sie wachsen in dieses Thema hinein. Wenn Kinder Fragen stellen, ist es wichtig, diese ohne Tabu und mit Klarheit zu beantworten. Kinder haben in erster Linie praktische und weniger philosophische Fragen. Gerade beim Tod, der uns Menschen naturgemäß Angst macht, soll man nichts beschönigen, verschleiern oder Halbwahrheiten erzählen. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass angsterfüllte Fantasien entstehen. Der Tod ist für den einzelnen Menschen traurig und die Trauer gehört zum Tod dazu. Trauer ist kein angenehmer Zustand, aber sie ist letztendlich Teil des Heilungsprozesses.
Hilft es, wenn ich damit tröste, dass Verstorbene in den Himmel kommen?
Pernlochner-Kügler: Selbst wenn ich vom Himmel und von Engeln erzähle, spüren Kinder, was das Thema mit uns macht. Sie haben ja sehr feine Antennen. Ich gebe Eltern immer den Rat, offen mit ihren Kindern zu sprechen und die Frage, was danach kommt, wahrheitsgemäß zu beantworten.
Aber die Wahrheit kennen doch selbst wir Erwachsenen nicht.
Pernlochner-Kügler: In verschiedenen Kulturen gibt es verschiedene Antworten auf diese Frage. Manche glauben, es geht danach weiter, andere nicht. Ich finde aber auch, dass es die Aufgabe von modernen Eltern ist, selbst wenn sie gläubig sind, zu sagen: Das ist nicht die Antwort aller. Mit diesen Fragezeichen müssen auch Kinder schon leben lernen. Zumeist können sie das gut. Unser Sohn hat mit fünf das erste Mal gefragt, was nach dem Tod passiert. Wir sind agnostische beziehungsweise atheistische Eltern. Wir haben gesagt: Der Papa glaubt nicht, dass danach etwas kommt. Ich glaube es eher auch nicht, aber ich lasse mich überraschen.
Das heißt, Kinder haben nicht gezwungenermaßen Angst vor dem Tod?
Pernlochner-Kügler: Die Angst vor dem Tod ist natürlich und schützt uns auch. Mit Informationen schaffe ich einen guten Boden. Damit kann ich Kindern viel Sicherheit mitgeben. Wenn Kindergruppen zu uns zur Führung ins Bestattungsunternehmen kommen, wollen sie alles ganz genau wissen. Viel genauer als die Erwachsenen. Die Begleitpersonen kriegen immer viel mehr das Gruseln.
Sie arbeiten regelmäßig mit Volksschulklassen zusammen, wie sieht das aus?
Pernlochner-Kügler: Spätestens in der Volksschule wird das Thema richtig interessant. In dieser Zeit wird Kindern bewusst, dass der Tod etwas Universelles ist und dass alle Lebewesen sterben. Ich nehme immer eine Urne mit Asche von einem Verstorbenen in die Klasse mit. Auf der Urne stehen der Name, das Geburtsdatum, das Sterbedatum und das Kremationsdatum. Dann fangen sie an zu rechnen, wie alt der Mensch geworden ist. Außerdem zeige ich eine Glasphiole mit Menschenasche, damit sie sehen, wie so etwas aussieht: Sehr grobkörnig. Wenn ich mit diesen Gegenständen komme, wollen sie alles Mögliche wissen: Wie viel bleibt über, wenn man verbrannt wird? Wie heiß ist es im Krematoriumsofen? Und wie fühlt es sich an, einen Toten anzufassen?
Sprechen Kinder auch über eigene Erfahrungen?
Pernlochner-Kügler: Oft fangen sie an zu erzählen, wo die Omas und Opas, die Katzen und Hunde gestorben sind und wie sie sie beigesetzt haben. Es ist eine lebhafte Stunde, wo sie vom Hundertsten ins Tausendste kommen.
Sie beschreiben in "Der Club der kalten Hände" verschiedene Verabschiedungsszenarien, zum Beispiel trinken die Angehörigen von der Tante Traudl Eierlikör. Ist es üblich, dass die Familie am Sarg etwas trinkt?
Pernlochner-Kügler: Die Angehörigen fragen oft, was sie bei der Verabschiedung am offenen Sarg tun sollen. Die Besuchszeit dauert meist zwei bis drei Stunden. Ich sage den Hinterbliebenen, dass sie Dinge mitnehmen können, die der Verstorbene gerne gegessen oder getrunken hat. Oft bringen sie das Lieblingsgetränk mit: Bei Kindern Kakao oder Eistee, bei Erwachsenen Whiskey oder Rotwein. Alles ist möglich. Wenn wir ein Glas in der Hand haben, hellt das die Stimmung auf und es können durchaus auch lustige Momente entstehen.
Im Buch stirbt auch ein Geschwisterkind. Die Bande rennt im Bestattungsinstitut wild um den offenen Sarg herum. Geht es manchmal wirklich so zu bei Ihnen?
Pernlochner-Kügler: Auch diese Geschichte hat einen realen Hintergrund. Die Verabschiedungen von Kindern verlaufen anders, weil meist andere Kinder dabei sind, die lebhafter reagieren. Wenn etwas zu belastend oder ihnen fad wird, dann fangen sie an zu spielen. Bei mir haben sich schon Enkel über den Sarg der Oma hinweg gegenseitig beworfen. Und natürlich dürfen sie das: Der Oma macht das nichts mehr und sie haben ihren Spaß.
Religion spielt kaum eine Rolle in Ihrem Buch. Warum?
Pernlochner-Kügler: Ich wollte bewusst keine Verabschiedung mit christlichem Hintergrund im Buch haben. Weil in fast allen Kinderbüchern zum Thema ohnehin christliche Rituale vorkommen. Diese Geschichte wurde schon oft beschrieben. Dafür erzähle ich in "Der Club der kalten Hände" von einer muslimischen Waschung. Bei Muslimen und Juden ist die Waschung zentral, im Christentum gibt es sie in dieser Form nicht mehr. Früher hat sie auch bei uns zuhause stattgefunden, da haben Familie und Nachbarn den Verstorbenen gewaschen, eingebettet und dann ist es auf den Friedhof gegangen. Hin und wieder kommen noch Angehörige, die fragen, ob sie den Verstorbenen waschen oder anziehen dürfen. Dann machen wir das möglich.
Werden Rituale in Zusammenhang mit dem Tod ganz allgemein weniger?
Pernlochner-Kügler: Nein, sie werden nur anders. Tatsächlich ist der Tod nicht mehr so vertraut wie noch Anfang des vorigen Jahrhunderts. Ich erkläre es mir so, dass durch die beiden Weltkriege der Tod sehr allgegenwärtig war. Danach waren die Menschen traumatisiert und brauchten vielleicht mehr Distanz dazu. In den 1950er-Jahren hat sich der Tod institutionalisiert. Er wurde immer mehr in die Krankenhäuser, Hospize und Altersheime verlagert. Auch die meisten Bestattungsunternehmen sind zu der Zeit entstanden. Durch die Verlagerung vom privaten in den professionellen Raum ist auch der vertraute Umgang mit dem Tod verloren gegangen. Aber es gibt eine Suche nach neuen Ritualen.
Wie schaut so ein Ritual bei einer Verabschiedung zum Beispiel aus?
Pernlochner-Kügler: Im kirchlichen Kontext ist die Verabschiedung oft eine sehr frontale Angelegenheit, mit dem Verstorbenen vorne beim Altar und den Trauergästen als Publikum. Auch bei weltlichen Feiern, wo der Trauerredner den Pfarrer ersetzt, ist es ähnlich. Wir stellen bei unseren Verabschiedungen den Verstorbenen buchstäblich in den Mittelpunkt und die Trauernden im Halbkreis um ihn herum. Wir versuchen, die Feier diskursiver zu gestalten, und laden Leute ein, spontan zu erzählen, woran sie sich gerne erinnern.
Finden die Menschen im Ausnahmezustand überhaupt Worte?
Pernlochner-Kügler: Es sind immer Leute dabei, die gerne reden. Das ist ein Selbstläufer. Zudem kann man symbolische Rituale der Verbindung machen, zum Beispiel mit Steinen: Einen legen wir dem Verstorbenen in den Sarg, den anderen können wir behalten. Bei der Gelegenheit kann man etwas erzählen oder auch nicht.
In Filmen verstreuen die Hinterbliebenen gerne die Asche der Verstorbenen. Darf man das in Österreich überhaupt?
Pernlochner-Kügler: In Österreich haben wir in jedem Bundesland ein anderes Bestattungsgesetz, aber ich darf in fast jedem Bundesland die Asche mit nachhause nehmen oder auf privatem Grund beisetzen. Nur verstreuen darf ich sie nicht, außer auf dafür vorgesehenen Wiesen auf Friedhöfen. Bei uns in Tirol ist es erlaubt, 20 Gramm pro Verstorbenem den Angehörigen mitzugeben. Und wenn jemand die verstreut, wird kein Richter etwas sagen. Das ist ein Graubereich.
Was spricht dagegen, Asche zu verstreuen?
Pernlochner-Kügler: Vordergründig ist in Tirol immer die Argumentation: Stellt euch vor, ihr fahrt auf der Skipiste und jemand leert vom Sessellift die Asche runter. Es bleiben zwar wirklich drei bis vier Kilo zurück, aber das sind trotzdem blödsinnige Argumente. Ich könnte das Gesetz ja auch so beschließen, dass das Verstreuen der Asche nur an weniger stark frequentierten Plätzen möglich ist. Ich vermute, es geht ums Geld. Es findet eine starke Abkehr von Friedhöfen statt und die Kommunen wollen ihre Gräber anbringen.
Ich dachte, man solle sich besser heute als morgen einen Grabplatz sichern.
Pernlochner-Kügler: Weil der Trend zur Feuerbestattung geht, werden immer mehr Grabflächen frei. In Innsbruck sind wir mittlerweile bei 80 Prozent Urnenbeisetzungen. Gerade im städtischen Bereich ist das die beliebtere Bestattungsform. Man kommt mit dem Betonieren von Urnen-Nischen gar nicht mehr nach.
Betonieren? Pernlochner-Kügler: Urnen werden in Beton-Nischen eingestellt. Furchtbar! Wir brauchen dringend alternative Bestattungsflächen, also Wiesen oder Wälder, wo die Überreste verrotten. In der Betonnische verrottet nichts. Für mich ist es auch keine schöne Geste, einbetoniert zu werden. Aber es ist natürlich pflegeleicht. Bei Erdbestattungen empfiehlt es sich immer den billigsten Weichholz-Sarg zu nehmen, der löst sich relativ schnell auf. Im Gegensatz zum edlen Mahagoni-Sarg, der bleibt für immer unter der Erde.
Wie möchten Sie selbst bestattet werden?
Pernlochner-Kügler: Vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, eine Feuerbestattung und dann eine weltliche Feier, mit lockerem Umtrunk und gutem Rotwein. Mittlerweile bin ich, was die Bestattungsarten angeht, eines Besseren belehrt worden. Die Feuerbestattung ist nicht ökologisch, sondern eine große Energieverschwendung. In Norddeutschland gibt es mittlerweile die sogenannte Reerdigung. Das ist ein Kompostierverfahren, das bei uns noch nicht im Gesetz verankert ist. Da bleiben 200 Kilogramm sauberer Humus über. Ohne Schadstoffe. Bei mir im Garten als Kompost verstreut, das kann ich mir gut vorstellen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: