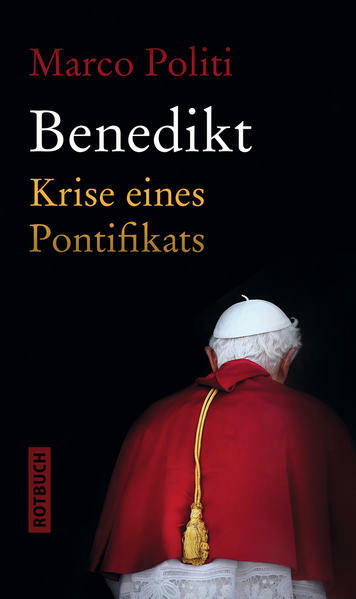Benedikt der Tragische
Franz Kössler in FALTER 7/2013 vom 13.02.2013 (S. 18)
Der Papst-Rücktritt hat die ganze Welt überrascht. Ein italienischer Journalist und Vatikan-Experte über die Regentschaft von Benedikt XVI.
Einige Minuten lang herrschte Sprachlosigkeit im Vatikan, als der Papst am vergangenen Montag seinen Rücktritt ankündigte. Die Demission kam ohne Vorwarnung und sie kam in lateinischer Sprache. Manch einer der Kardinäle zweifelte an der Zuverlässigkeit seiner Sprachkenntnisse, andere konnten sich einen historisch so außergewöhnlichen Schritt nicht vorstellen: Zum letzten Mal war im Jahr 1294 ein Papst zurückgetreten. Es wird schwierig werden, Benedikt XVI. seiner Bedeutung nach in die Kirchengeschichte einzuordnen.
Marco Politi, dessen Buch "Benedikt. Krise eines Pontifikats" im November auf Deutsch erschienen ist, interpretiert den Rücktritt als einen letzten Reformschritt des umstrittenen Papstes. Dessen Vorgänger, Johannes Paul II., hatte schon einmal einen Kardinal beauftragt, die Hypothese eines Papst-Rücktritts zu analysieren. Das Ergebnis war: kirchenrechtlich durchaus möglich, aber die katholische Kirche sei für einen solchen Schritt nicht bereit. Karol Wojtyła blieb trotz seiner schweren Krankheit Papst bis zu seinem Tod. Joseph Ratzinger holt das Amt auf seine säkular-menschliche Ebene zurück. Angesichts schwindender Kräfte wird er sich in ein Kloster im Vatikan zurückziehen.
Einst ein Reformer
Während seines Pontifikats war er in der Praxis freilich alles andere als ein Reformer. Er war mit dem intellektuellen Anspruch angetreten, die Stellung der katholischen Kirche in der säkularisierten Welt zu behaupten, sich mit der Moderne auseinanderzusetzen, ohne sich dem Zeitgeist zu ergeben.
In dieser Dialektik hat er die katholische Kirche von einer Krise zur anderen geführt und ihre geopolitische Rolle geschwächt. "Letzten Endes", schreibt Marco Politi, "ist Joseph Ratzinger eine tragische Figur."
Ältere erinnern sich an Ratzinger als einen aufgeschlossenen Professor in Tübingen und aktiven Reformer beim Zweiten Vatikanischen Konzil, das die Öffnung der erstarrten katholischen Kirche zur modernen Welt brachte. Bis sich der Theologe, vom antireligiösen Radikalismus der Studentenbewegung aufgeschreckt, auf konservative Positionen zurückzog und zum dogmatischen Hüter der reinen Lehre wurde.
Reihenweise verpasste er als Leiter der Glaubenskongregation kritischen katholischen Denkern Publikations- und Lehrverbote. Die Inhalte des Konzils wurden im konservativen Sinne uminterpretiert. Nicht die liberalen Öffnungen, der Dialog mit Nicht- oder Andersgläubigen, die Brüche sollten hervorgehoben werden, sondern die Kontinuität zum vorkonziliären Konservatismus, zum exklusiven Wahrheitsanspruch der katholischen Hierarchie.
So wird die Sprengkraft der Erneuerung entschärft. Basisbewegungen wie auch die österreichische, die Demokratie und ein neues Frauenbild in der Kirche fordern, werden als Bedrohung verstanden und entsprechend bekämpft. Der Reformtheologe Hans Küng, ein Mitkämpfer Ratzingers zu Zeiten des Konzils und später Opfer eines Ratzinger'schen Lehrverbots, wirft ihm offen Verrat an den Idealen des Konzils vor.
Es ist kein Zufall, erklärt Politi in seinem Buch, dass für Benedikt XVI. die Versöhnung mit den ultrakonservativen Piusbrüdern höchste Priorität erhält. Sie hatten sich aus Opposition gegen die Reformen des Konzils abgespalten.
So hastig wird unter Benedikt XVI. ihre Wiedereingliederung betrieben, dass die kirchliche Bürokratie übersieht, dass einige von ihnen offen antisemitische bis neonazistische Thesen vertreten. Der Vatikan muss sich entschuldigen.
Andere Fehltritte unterhöhlen die geopolitische Bedeutung des Vatikans, der immerhin im Namen von mehr als einer Milliarde Katholiken auftritt. Die islamische Welt reagiert verärgert auf ein Zitat in einer theologischen Rede des Papstes, in der dem Islam ein Naheverhältnis zur Gewalt unterstellt wird. Die jüdische Welt ist verstimmt, weil der Papst zwar den Holocaust verurteilt, aber nicht den korrekten Begriff Shoah verwendet.
In Marco Politis Analyse trifft die Verantwortung nicht den Papst allein, der oft eigenwillig entscheidet. Auch seinem Team mangelt es an politischem Feingefühl. Politi zeichnet das Bild eines isolierten, intellektuell hervorragenden, konservativen Theologen, der über keine Management- und politische Führungsqualitäten verfügt und der von einer distanzierten römischen Kurie nur unzureichend unterstützt wird.
Progressiver Konsens
Vergeblich wartet auch die katholische Welt selbst auf eine zeitgemäße Antwort auf die drängenden Fragen der Gesellschaft, zu denen die katholische Morallehre immer isolierter und unzeitgemäßer erscheint.
Es gibt keinen Fortschritt in den Fragen der Sexualmoral, der Familienplanung, der künstlichen Befruchtung, der neuen Lebensgemeinschaften. Es hat sich ein Reformstau gebildet, der für den im März zu wählenden Nachfolger Ratzingers eine außerordentliche Herausforderung darstellt.
Der Arithmetik nach zeichnet sich eine Auflösung des Reformstaus auch jetzt nicht ab: Die Mehrheit der wahlberechtigten Kardinäle gehört wieder dem konservativen Lager an. Doch es wäre nicht das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass sich unerwartet eine neue, reformerische Strömung bildet.
Die Hindernisse dafür sind nicht so groß, wie sie noch unter Johannes Paull II. gewesen wären. Johannes Paul II. hat 1996 die Papst-Wahlordnung geändert, um einen liberalen Pontifex zu verhindern.
Ratzinger hat das wieder zurückgenommen: Ein neuer Papst muss nun wieder mit einer breiten Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt werden, was, nach zähem Auswahlprozedere, die Chancen für einen progressiven Konsens erhöhen könnte.