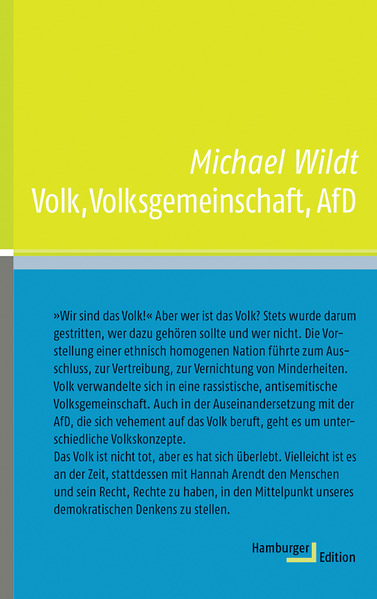Von der Menschenmenge zu den aggressiv Artgleichen
Rudolf Walther in FALTER 10/2017 vom 08.03.2017 (S. 18)
Rechts-, aber auch Linkspopulisten sprechen gerne vom Volk. Der Historiker Michael Wildt hat die Begriffsgeschichte analysiert
Mit dem Begriff Volk verbinden sich seit jeher zeit- und gesellschaftssystemübergreifend erhebliche intellektuelle Zumutungen. Sprachen antike Autoren von höchster Reputation wie etwa Aristoteles vom Volk (griechisch: demos), waren ganz selbstverständlich nur ökonomisch unabhängige, freie, männliche Bürger gemeint. Einfache Handwerker, Frauen, Mägde, Knechte und Sklaven gehörten nicht zum politischen Volk. In der Schweiz, wo sich eine Mehrheit bis heute für von der Vorsehung gesegnete Demokraten hält und sich zum Märchen der Urdemokratie bekennt, war die politisch stimmberechtigte Vollbürgerschaft immer an das männliche Geschlecht gebunden. Frauen gehören in der Schweiz erst seit 1972 zum Volk. Und wenn es nach dem Drittel von konservativen Berufsschweizern ginge, die es mit der SVP halten, wären die Frauen wohl bis heute nicht gleichberechtigt. In Ostdeutschland mutete man den Bürgern nach 1945 zu, in einer „Volksdemokratie“ zu leben, also in einem hybriden Gebilde, das auf dem Unsinn eines arithmetisch mindestens verdoppelten, nach der Propaganda eher quadrierten „Volkes“ beruht – also der „Volks-Volks-Herrschaft“.
Der Begriff „Volkswille“ schließlich gehört ganz selbstverständlich zum Alltagsvokabular von Demokraten, obwohl es auf der Hand liegt, dass das Volk kein Subjekt ist und folglich keinen Willen hat. Personen können sich aber im Namen ihres je individuellen Wollens vereinigen und sich für den „Volkswillen“ halten.
Der Berliner Historiker Michael Wildt vermisst die Untiefen und Zumutungen, die dem Volksbegriff seit der Antike eigen sind, in seinem Buch mit großer Sachkunde. Es geht ihm darum, „die glänzend glatte Fassade des Begriffs beiseitezuschieben und die buntscheckige und mitunter hässliche Realität des Volkes zur Kenntnis zu nehmen.“
Volk und Nation werden eins
Erst Kant begriff das Volk nicht mehr als Abstammungs-, Sprach- oder Kulturgemeinschaft, sondern als eine durch das Recht geordnete und vereinigte „Menge Menschen“. Aber selbst der Aufklärer schränkte die Staatsbürgerschaft auf wirtschaftlich selbstständige Männer ein und schloss damit Frauen, Knechte und Dienstboten aus.
Ausgesprochen prekär ist das Verhältnis von Volk und Nation, da man im Zeitalter des Nationalstaats Staatsbürgerschaft und Nationalität kurzschloss und so – je nach Interessenlage – die ethnische Herkunft, die Sprache oder die Religionszugehörigkeit zum Kriterium der Zugehörigkeit bzw. des Ausschlusses machte. Aus dieser Konstruktion resultierte ein Druck zur national bzw. ethnisch, religiös oder kulturell akzentuierten Homogenisierung der Bevölkerung mit dem Ziel, Bevölkerungsgruppen, die nicht zur ethnisch, religiös oder kulturell definierten „Normalität“ passten, rechtlich zu diskriminieren, zu vertreiben oder im Extremfall zu töten.
In diesem Prozess der Selbstbestimmung und Selbstfindung unter nationalen Vorzeichen spielte der Begriff „Volksgemeinschaft“ eine zentrale Rolle. Im harmloseren Falle dient er dazu, eine von politischen Krisen, sozialen Unruhen oder militärischen Niederlagen gezeichnete und gespaltene Gesellschaft zur Einheit zu ermuntern. Exemplarisch geschah das in der Weimarer Republik. Damals traten von den sozialdemokratischen über die linksliberalen bis zu den rechtsliberalen und konservativen politischen Eliten alle für eine Volksgemeinschaft ein, um die Revolution, Kriegsverluste und Inflation politisch, sozial und ökonomisch zu bewältigen.
Völkisches Empfinden
Nationalsozialisten und ihre radikalkonservativen Vordenker wie der Jurist Carl Schmitt machten die Zugehörigkeit zum Volk wie zur rechtlichen und politischen Gleichstellung von der „Artgleichheit“ bzw. „Rasse“ abhängig. „Der Andersdenkende, Andersempfindende und Andersgeartete“ sollte erst mundtot, dann ausgebürgert und im Extremfall ausgemerzt werden, genauso wie „das Andersdenken als solches“, das das „völkische Empfinden“ gefährde, wie Schmitt 1934 die spätere Praxis der nationalsozialistischen Diktatur vorab herbeischrieb. Die „deutsche Volksgemeinschaft“ wurde im Laufe des Krieges zur „Raubgemeinschaft“ (Michael Wildt) am Leben und Vermögen „Andersartiger“ in ganz Europa.
Nach 1945 verschwand der Begriff „Volksgemeinschaft“ zwar aus dem politischen Vokabular, fand aber eine „sekundäre Bestätigung“ im Umgang der Wirtschaftswunderdeutschen mit Emigranten, denen misstraut wurde, und mit nationalsozialistischen Tätern, die man kalt amnestierte oder gar nicht erst anklagte. Aus der „Volksgemeinschaft“ wurde im Zuge des Wirtschaftswunders schnell eine „Erfolgsgemeinschaft“ (Malte Thießen), die vor allem eines im Sinne hatte: „Wir sind wieder wer“ und vergessen alles. Erst nach dem großen Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963–65 und der Studentenbewegung von 1967/68 gewann die Kritik an der selbstgerechten Gemeinschaft des Vergessens an Boden und der Protest gegen die „Normalisierung“ an Resonanz in der Öffentlichkeit.
Mit dem Aufkommen der AfD droht Wildt zufolge keine Wiederkehr der alten Volksgemeinschaft, aber eine Verharmlosung ihrer Geschichte. Dies geschieht vor allem durch die Positivierung der negativ besetzten Begriffe. Das Führungspersonal der AfD spricht von „Umvolkung“, möchte das Wort „völkisch“ wiederbeleben oder nennt „Volksgemeinschaft“ einen „positiven Ausdruck“. Diese Taktik ist jedoch so durchschaubar wie die Realität hinter der Kampfparole „Wir sind das Volk“. Die AfD meint damit: „NUR WIR sind das Volk.“ – Das Buch von Wildt bietet beste politische Aufklärung.