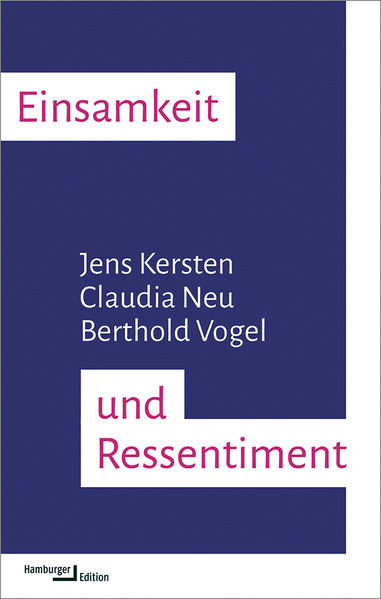Die Wut der Einsamen
Lina Paulitsch in FALTER 8/2025 vom 19.02.2025 (S. 27)
Wenn Sie diesen Text lesen, löst das wahrscheinlich ein bestimmtes Gefühl bei Ihnen aus. Es soll um das Thema Einsamkeit gehen, und die meisten haben sich schon einmal einsam gefühlt. Vielleicht sind Sie gerne allein und ärgern sich über gefühliges Gedöns. Vielleicht haben Sie sich aber schon einmal so verlassen gefühlt, dass Sie in Ihrem Innersten erschüttert waren.
Sie sehen, Einsamkeit ist eine subjektive Emotion. Jeder erlebt sie anders. Aber - und darum soll es in diesem Text gehen -sie betrifft nicht nur den Einzelnen. Wer sich einsam fühlt, weil er einen Verlust erlitten hat, der fühlt sich oft auch der Gesellschaft nicht zugehörig. Und das tun seit einigen Jahrzehnten immer mehr. Mit weitreichenden Folgen.
In Österreich fühlte sich 2024 laut einer Studie des Sora-Instituts jeder Vierte einsamer als vor der Pandemie. Caritas-Chef Klaus Schwertner spricht von einer "Zivilisationskrankheit". Deutschland verabschiedete eine "Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit", in Großbritannien gibt es ein eigenes "ministry of loneliness". Spätestens seit der Pandemie warnen Forscher vor politischen Folgen: Einsamkeit ist eine Gefahr für die Demokratie. Einsame hegen Misstrauen gegen staatliche Institutionen. Und sie legitimieren eher politische Gewalt.
Einsamkeit ist damit eine persönliche und eine soziale Frage. Dass Menschen so bereitwillig in die Arme autoritärer Führer laufen, hängt auch mit deren Angebot einer Gemeinschaft, eines Gemeinsinns, zusammen. Und damit mit dem Kontrapunkt zum Alleinsein.
Der psychological turn
Einsame wünschen sich mehr soziale Kontakte -egal, ob sie welche haben oder nicht. Ein gestresster Familienvater kann ebenso betroffen sein wie eine Frau mit vielen, aber oberflächlichen Beziehungen. Sie sind keine Eigenbrötler, die gerne durch die Natur wandern oder meditieren. Anders als wohltuendes Alleinsein ist Einsamkeit schambesetzt und ungewollt.
Biologisch ist der Mensch nicht fürs Alleinsein gemacht. Wer mehr als acht Stunden allein verbringt, beginnt Stresshormone auszuschütten. Und wird krank: Isolation ist genauso schädlich wie 15 Zigaretten pro Tag. Das Risiko für Herzinfarkt und Demenz steigt um 30 Prozent, das Immunsystem schwächelt.
Bis dato hat sich eher die Psychologie mit dem Thema beschäftigt. Nun entdecken auch Sozial-und Politikwissenschaftler das Gefühl für sich - im Rahmen eines Paradigmenwechsels, des sogenannten psychological turn. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts hatte der linguistic turn die Geisteswissenschaft verändert, indem man zu untersuchen begann, wie die Sprache unsere Wirklichkeit prägt. Jetzt rücken Emotionen in den Vordergrund. Begriffe wie Vulnerabilität, Resilienz und Resonanz tauchen nicht nur auf Instagram, sondern auch in Uni-Seminaren auf.
"Lange dachte man, wenn es Menschen wirtschaftlich besser geht, dann wählen sie auch demokratischer. Nur geht es ihnen heute verhältnismäßig gut", sagt Claudia Neu, Soziologin an der Uni Göttingen. "Wahrnehmungen werden immer wichtiger -gefühlte Wahrheiten."
Einsamkeit und Ressentiment
Claudia Neu ist in Deutschland eine Pionierin der sozialen Einsamkeitsforschung, die gerade erst entsteht. Gemeinsam mit dem Juristen Jens Kersten und dem Soziologen Berthold Vogel hat sie das Buch "Einsamkeit und Ressentiment" geschrieben. Die beiden titelgebenden Emotionen treten laut ihrer Forschung gehäuft gemeinsam auf.
In einer Studie, die 2023 im Auftrag der deutschen Bundesregierung entstand, zeigt das individuelle Schicksal sein politisches Gesicht. Einsame gehen seltener wählen, sie neigen zur Unterstützung populistischer Kandidaten und extremen politischen Einstellungen. Und sie vertrauen eher dem Internet als öffentlich-rechtlichen Medien. Insgesamt fühlen sie sich politisch machtlos -und nicht gehört.
Wer Ressentiments hat, der fühlt sich ohnmächtig. Er frisst Gefühle der Kränkung in sich hinein. Und überträgt Groll, Zorn und Hass auf die Gesellschaft. Ein Beispiel: Ein Mann kann nicht akzeptieren, dass seine Frau ihn verlassen hat. Ist er dann auch noch allein mit seinen Gefühlen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er die Schuld außerhalb sucht. Oder sich völlig zurückzieht. Beides ist für eine Demokratie, die von Beteiligung lebt, nicht gut.
"Das Ressentiment speist sich aus einer Unrechtserfahrung, die nicht losgelassen werden kann", erklärt die Soziologin. "Menschen mit Ressentiments steigern sich immer wieder hinein, können die Wunde nicht schließen - und das führt zu noch mehr Einsamkeit."
Blickt man in die Daten, so stieg die Zahl der Einsamen von 2013 bis 2017 auf gut zehn Prozent der Bevölkerung an. Während der Pandemie schnalzten die Werte in die Höhe, nun pendeln sie sich langsam wieder ein. Nur bei einer Gruppe nicht: der Jugend.
Im vergangenen Jahr befragte die deutsche Bertelsmann Stiftung mehr als 23.000 Menschen in der EU. 57 Prozent der 18-bis 35-jährigen Europäerinnen und Europäer fühlen sich einsam, so das Ergebnis, 17 Prozent sogar "stark". Anders als Erwachsene haben sich jüngere Menschen nicht von der Corona-Pandemie erholt.
Warum sind gerade junge Menschen betroffen? Eine Erklärung klingt fast schon banal, weil sie so oft genannt wird: soziale Medien. Zwar haben sie auch positive Effekte. Außenseiter können online leichter Kontakte knüpfen, Enkel ihre entfernt lebenden Großeltern hören.
Für viele entsteht auf Plattformen wie Instagram und Tiktok aber ein Gefühl des Mangels: dass andere noch mehr Freunde haben als sie selbst, noch mehr Spaß und mehr erfüllte Beziehungen. Einsamkeit ist relational, sie entsteht im Vergleich.
Jugendliche, die sich allein fühlen, sind laut einer deutschen Erhebung empfänglicher für Verschwörungstheorien. Und sie neigen eher dazu, Gewalt zu legitimieren. Dieser Befund deckt sich mit Daten zum starken Wählerzustrom, den die deutsche Rechtsaußen-Partei AfD aktuell von Jugendlichen erfährt.
Hannah Arendts Verlassenheit
Sucht man eine frühe politische Theorie der Einsamkeit, findet man sie bei der deutsch-amerikanischen Philosophin Hannah Arendt. In ihrem Monumentalwerk "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft", das Anfang der 1950er-Jahre erschien, verknüpfte Arendt Gefühle der Einsamkeit mit autoritären Systemen.
Mehr noch, Arendt sieht hierin die Essenz für den Erfolg der Nationalsozialisten.
"Es ist, als breche alles, was Menschen miteinander verbindet, in der Krise zusammen, so dass jeder von jedem verlassen und auf nichts mehr Verlass ist", schreibt Arendt. Das existenzielle Gefühl der Verlassenheit ist für Arendt der "Rohstoff zu allen einstigen und künftigen Experimenten totalitärer Herrschaft". Einsamen Menschen erscheint das "eiserne Band des Terrors" als letzter Halt.
Bis heute bestimmt der lange Schatten der Arendt'schen These die Einsamkeitsforschung. Prominent gemacht hat sie die britische Ökonomin Noreena Hertz. Ihr 2020 erschienenes Buch "Das Zeitalter der Einsamkeit" belegt Arendts Gedanken in weiten Teilen. Um die Demokratie zu retten, so Hertz' Ansage, müssten sich Gesellschaften ihren Einsamen widmen.
Hertz begann ihre Forschung zufällig. Im Jahr 2018 stellte sie sich die Frage, warum Menschen rechtspopulistische Parteien wählen. In Interviews in Frankreich, den USA und Deutschland entdeckte sie eine Konstante. Die Menschen klagten, sich allein zu fühlen. Erst in der jeweiligen rechtspopulistischen Partei hätten sie Zugehörigkeit gefunden. Oft kamen die Menschen aus Familien, die traditionell links gewählt hatten.
Bedrohung von außen
"Einsame Menschen nehmen die Welt als bedrohlicher wahr", sagt Hertz. "Wir wissen aus Tierstudien: Je länger eine Maus in einem Käfig isoliert wird, desto gewalttätiger reagiert sie auf andere Mäuse, die zu ihr gelassen werden."
Rechte bis rechtsextreme Parteien schaffen es, Gefühle der Bedrohung mit einem Gemeinschaftsversprechen zu verknüpfen. FPÖ-Chef Herbert Kickl ist auf Wahlplakaten mit seinen Wählern grundsätzlich per Du. US-Präsident Donald Trump beschwört einen Kampf der Kulturen und verspricht, auf der richtigen Seite zu stehen.
Besonders anschaulich ließ sich das während der Pandemie beobachten. In Österreich brachte die FPÖ Menschen aus völlig unterschiedlichen Milieus zusammen. Wer sich impfen ließ und wer nicht, wurde zum Marker der Zugehörigkeit. Und zwar über die Landesgrenzen hinweg. Bis heute kommen deutsche Stars der Maßnahmengegner nach Wien, die Politologin Ulrike Guérot etwa oder die Kabarettistin Monika Gruber. Die Pandemie ist immer noch ein wahlentscheidender Faktor, auch weil die damalige Gemeinschaft bis heute besteht. Und sich politisch rechts verortet.
Im Kern liege das Versagen der Linken darin, sagt Noreena Hertz, zu wenig Gemeinschaft zu stiften. Realpolitische Faktoren - Löhne, Steuern, Pension -spielen beim Wählerfang eine weniger große Rolle als Gefühle. Und die schaffen linke Parteien weniger zu triggern.
Dass Rechtspopulisten ehemals linkes Kerngebiet einnehmen, lässt sich am Begriff der Solidarität, Schlagwort der Arbeiterbewegung, beobachten. Zu Beginn der Pandemie, im März 2020, zeigte sich die breite Gesellschaft solidarisch mit dem Gesundheitspersonal. Um 18 Uhr wurde auf Balkonen geklatscht und Musik gespielt. Ein Jahr später kippte die Stimmung. "Friede, Freiheit, Solidarität!", skandierten Menschen auf Demos gegen Lockdown und Impfung. Solidarität bezog sich nicht mehr auf die Schwachen, sondern auf eine exklusive Gruppe: die Widerständigen, Ungeimpften, die sich gegen Übermächtige zur Wehr setzen. Ein leichtes Spiel für jene Politiker, die ihnen Beistand versprachen.
Die Corona-Krise belegte viele Thesen der Einsamkeitsforschung. Das Vertrauen in staatliche Institutionen erodierte, in der Wut mischte sich privates mit politischem Schicksal. Kontaktbeschränkungen, die für die einen ärgerlich waren, rüttelten bei anderen am Selbstverständnis als freies Individuum.
Warum sind wir einsam?
"Jeder Mensch ist manchmal einsam", sagt Neu. "Die Frage ist, ob man das Gefühl als Erfahrung ins Leben integrieren kann, wie etwa Trauer." Dass die einen es schaffen, Phasen der Isolation zu überwinden, und die anderen in ihnen verharren, ist nicht in Daten messbar. Einsame gibt es quer durch alle Gesellschaftsschichten.
Allerdings gibt es Risikofaktoren. Arme und Arbeitslose fühlen sich häufig alleingelassen, auch Menschen in strukturschwachen Regionen. Auf dem Land, wo Infrastruktur fehlt.
Ein weiterer, immer wichtigerer Faktor: der Migrationshintergrund. 14 Prozent der Geflüchteten in Deutschland fehlt jegliche Bezugsperson, betroffen sind primär Männer. Sie neigen auch eher zu extremen Einstellungen. Und finden eine Gruppe im Internet, wie Beispiele von radikalisierten Attentätern zeigen (aus aktuellem Anlass, siehe Seite 11).
In der Gesellschaftstheorie ist viel über die Gründe der Einsamkeit nachgedacht worden. Über Jahrtausende waren Menschen in enge soziale Korsette gezwängt: Familienverbände, Kirche, Landwirtschaft. Die Befreiung von dieser Willkür führte zu einer größeren Individualisierung, zu mehr Freiheit in der Karriere-und Familienplanung. Vereine und gemeinschaftliche Institutionen verlieren an Bedeutung, es gibt mehr Singles denn je zuvor. Und mehr Einsamkeit.
Kulturpessimismus ist allerdings nicht angebracht. Insgesamt haben Menschen heute sogar mehr Freundschaften als früher. Eine individualisierte Gesellschaft führt nicht automatisch in die Isolation. Sie begünstigt sie nur.
Bubble ohne Kompromisse
"Wir können nachweisen, dass sich Menschen immer weniger begegnen", sagt Soziologin Neu. "Ich kann mir heute wesentlich stärker aussuchen, wen ich treffe und wen nicht." Das Home-Office sei so ein Beispiel. Für viele ist es angenehm, Konflikten mit Kollegen aus dem Weg zu gehen und von daheim aus zu arbeiten. Dadurch findet aber auch weniger Austausch, weniger Reibung statt. "Menschen heiraten immer ähnlicher, also innerhalb ihrer Bubble, und sie ziehen in ähnlichere Stadtviertel."
Wer sich immer weniger mit anderen auseinandersetzen muss, ist auch nicht gezwungen, Kompromisse einzugehen. Das spiegelt die Diskussionskultur in sozialen Netzwerken. Dort hallen verschiedene Meinungen in verschiedenen Echokammern, ohne gegen Widerspruch bestehen zu müssen. Kompromisslosigkeit ist Zeitgeist. Eine Konsequenz totaler Freiheit, die sich in der Einsamkeit als Unfreiheit entpuppt.
"Wenn man sich selbst als zu wenig wertgeschätzt sieht, dann bleibt kein Platz für andere, dann zählt nur das eigene Ich, die eigene Befindlichkeit, das eigene Sorgenregister", schreiben Claudia Neu und ihr Kollege Berthold Vogel. Einsame gehen weniger auf andere zu. Sie verhärten in ihrer Meinung -und prägen die polarisierte Struktur der Gesellschaft.
Was also tun gegen die Einsamkeit? Hebel gäbe es viele, sagt Ökonomin Noreena Hertz. Social Media regulieren und ein Mindestalter einführen wäre eine Möglichkeit. Und es brauche mehr Vereine, mehr öffentliche Parks und Plätze, Bibliotheken und öffentliche Infrastruktur. Vor allem aber ein Bewusstsein dafür, wie stark das Alleinsein am Vertrauen in staatliche Institutionen nagt. Mehr Offenheit für eine schambesetzte Emotion.
In einer Welt, in der wir messen, evaluieren und bestimmen wollen, geht es darum, Irrationalitäten zu akzeptieren. Es ist schwer, Gefühle auszulöschen oder umzukehren. Aber man kann sie adressieren, einhegen und in politische Bahnen lenken. Denn Demokratien überleben nur mit Zuspruch -wenn Menschen sich ihrem Gefüge zugehörig fühlen.