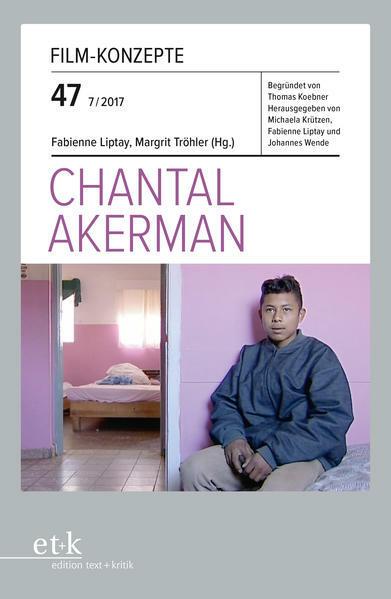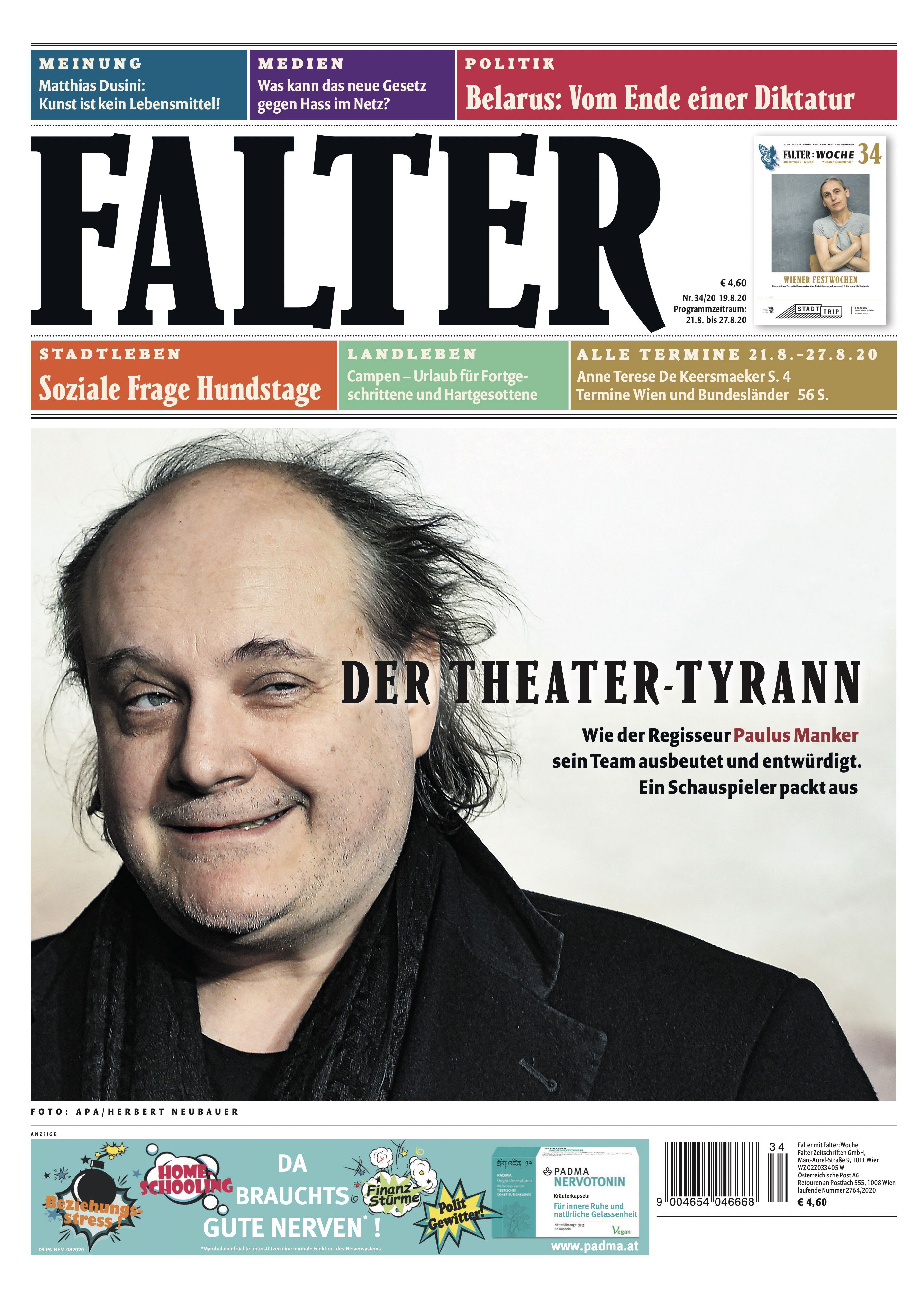
Kein anderer Blick
Michael Omasta in FALTER 34/2020 vom 19.08.2020 (S. 30)
Eine der Schlüsselszenen aus Mark Cousins neuem Werk stammt aus dem Oscar-prämierten Dokumentarfilm „Harlan County, USA“. Barbara Kopple berichtet darin vom Streik in einem Kohlerevier in Kentucky, der landesweit Schlagzeilen macht und die Bergarbeiter schließlich bis nach New York führt. Bei der Kundgebung dort schnappte Kopple ein Gespräch zwischen einem Kumpel und einem Cop auf, der mit den Demonstranten sympathisiert – und doch bass erstaunt ist, als sein Gegenüber ihm erklärt, dass es sich keineswegs um den Beginn eines Streiks handle, sondern dieser Arbeitskampf bereits seit über neun Monaten tobt.
Ähnlich erstaunt dürfte der geneigte Kinogänger sein, der sich die Zeit für Cousins fünfteiliges Epos „Women Make Film“ nimmt und geballt 130 Jahre quasi „alternative“ Filmgeschichte kennenlernt. Die insgesamt 14 Stunden lange Dokumentation, die in hunderten Ausschnitten schlaglichtartig das Schaffen von über 180 Regisseurinnen aus aller Welt beleuchtet, ist nächste Woche an fünf Abenden hintereinander im Österreichischen Filmmuseum zu sehen. Dazu hat der Kurator und Filmemacher Cousins fünf Werke ausgesucht, die im Ganzen gezeigt werden.
Beispielsweise einen Film von Edith Carlmar, in den 1950ern Norwegens erfolgreichste Filmschaffende überhaupt. Zusammen mit ihrem Mann gründete die frühere Schauspielerin nach dem Zweiten Weltkrieg eine eigene Produktionsfirma und entdeckte Stars wie Liv Ullmann für das Kino. Diese gibt auch die Hauptrolle in „Ung flukt“ („Die jungen Sünder“, 1959), ein flatterhaftes Mädchen namens Gerd, das von einem kreuzbraven Burschen aus kleinbürgerlicher Familie zu einem Ausflug in eine halbverfallene Waldhütte entführt wird, wo sie ein paar Tage fast unbeschwerten Glücks verbringen.
Carlmar eröffnet ihren Film als Roadmovie. Die beiden jungen Ausreißer sausen im geborgten VW-Käfer durch die Nacht. Interpunktiert wird die Fahrt von mehreren knappen Rückblenden, in denen der familiäre Hintergrund der Teenager ausgeschildert wird. Gerd steht auf Kriegsfuß mit ihrer Mutter und mit der Fürsorge; sie treibt sich im Hafen von Oslo herum, lässt sich mit Schmugglern ein und wird kurzzeitig festgenommen. Anders, der im Herbst auf die Universität gehen soll, gerät in Konflikt mit seinen Eltern, weil sie finden, dass Gerd kein guter Umgang ist.
„Ung flukt“ taucht in der Dokumentation, wie die allermeisten der gut 700 zitierten Filme, mehrmals und in unterschiedlichen Zusammenhängen auf. Darüber hinaus mag die Anfangsmontage – Fahrt, innere Erzählung, Rückblenden – Cousins auch zur Struktur von „Women Make Film“ inspiriert haben: „A New Road Movie Through Cinema“ lautet der Untertitel, und Straßenaufnahmen aus dem fahrenden Auto sind willkommene Ruhepausen zwischen den unter anderen von Jane Fonda, der Bollywood-Legende Sharmila Tagore sowie Tilda Swinton – die hier auch als ausführende Produzentin zeichnet – kommentierten Filmausschnitten.
Kino ist ein „Boys’ Club“, heißt es einleitend, und „sexistisch durch Auslassung“. Doch statt der besonderen Herausforderungen, denen Filmemacherinnen sich stellen mussten und immer noch müssen, nimmt die Dokumentation sogleich die ungeheure Vielfalt ihres oft weithin vergessenen Schaffens in den Blick. Cousins schreibt mit „Women Make Film“ kein Opfernarrativ fort – lädt zur Feier und Wiederentdeckung brillanter Filmemacherinnen ein.
Dabei folgt er keiner Chronologie oder geografischen Ordnung, sondern geht frei assoziierend vor. In insgesamt 40 Kapiteln wird das gesichtete Material befragt: Wie beginnt ein Film? Worin liegt die Magie des Close-ups? Wie werden Körper inszeniert? Was hat es mit Traum und Surrealismus auf sich? Wie geht Spannung? Was erzählt Heimat? Wie kommt im Kino der Tod?
Das klingt, so hingeschrieben, didaktischer, als es ist. Vielmehr kann man „Women Make Film“ – wie auch schon Mark Cousins’ vorangegangene dokumentarische Odyssee „A Story of Film“ (2011) – eine Schule des Sehens nennen. Es ist ein Plädoyer für größtmögliche Differenzierung, mithin: eine Kampfansage gegen die Gleichmacherei einer globalen Filmästhethik, gegen die totale Hollywood-Verblödung.
Die 14-Stunden-Doku ist ein guter Anfang, denn fast jeder Ausschnitt wird so einladend präsentiert, dass man am liebsten sofort den ganzen Film sehen möchte. Um zu veranschaulichen, dass sich das in der Praxis dann mitunter als recht mühsam erweisen kann, sei hier nur Kira Muratova erwähnt. Die ukrainische Regisseurin, die mittlerweile unter Kuratoren zu den bedeutendsten Filmemacherinnen überhaupt zählt, debütierte 1967 mit „Kurze Begegnungen“, einer mitreißenden Ballade, die bereits ihre Vorliebe für experimentelles Erzählen bezeugt. Doch etliche spätere Werke, insbesondere Muratovas komödiantisch angelegten Filme, erweisen sich in ihrer Mischung aus exaltiertem Schauspiel, kruder Synchrontechnik und kaum nachvollziehbarem Wortwitz als eher schwer genießbar.
Auf den Hintergrund einzelner Produktionen geht die Dokumentation nur in Ausnahmefällen ein. Sie setzt die Regisseurin zwar absolut, beschränkt ihr Interesse jedoch nicht auf den klassischen „Autorenfilm“, sondern bezieht Genrekino und US-Mainstream ebenso mit ein. So etwa Mary Harrons deftige Verfilmung von „American Psycho“ (mit Christian Bale in der Rolle des eiskalten Soziopathen) oder Kathryn Bigelows explosive Gewaltstudien wie „Point Break“ oder ihr kaum noch erinnertes Langfilmdebüt „The Loveless“ (Co-Regie: Monty Montgomery) mit Willem Dafoe.
Apropos. Auf die Idee, dass es einen „weiblichen Blick“ gäbe – quasi als Gegenstück zum objektivierenden „männlichen Blick“ des Kinoapparats, den die britische Filmtheoretikerin Laura Mulvey in den 1970ern erstmals so benannt hat –, reagiert Cousins allergisch. Über die Feststellung, „Kathryn Bigelow mache Filme wie ein Mann“ rege er sich fürchterlich auf, wird Cousins im Gespräch mit der Financial Times zitiert: „Kathryn Bigelow macht Filme wie Kathryn Bigelow!“
Zu ihren direkten Vorläuferinnen zählt die britische Schauspielerin Ida Lupino. Sie war die einzige Frau im Hollywood der 1950er-Jahre, die auch Regie führte, und brillierte ausgerechnet im Film noir. Doch die Ahnengalerie reicht bis zu den Anfängen des US-Kinos zurück: zu Filmpionierinnen wie Alice Guy-Blaché und Lois Weber, zu Actionheldin Nell Shipman oder Studiogründerin Mary Pickford.
Nicht anders verhielt es sich in Europa. In der Sowjetunion reüssierte Olga Preobraženskaja mit dem lyrischen Drama „Die Frauen von Rjasan“. In Deutschland gelang Leontine Sagan mit „Mädchen in Uniform“ ein Welterfolg, bevor wenig später die Nazi-Filmerin Leni Riefenstahl mit „Olympia“ triumphierte. Und in Frankreich bereitete Germaine Dulac mit Meisterwerken wie „Die Muschel und der Kleriker“ der internationalen Avantgarde den Weg.
„Dulac“, beschrieb die Filmhistorikerin Heide Schlüpmann, „gehörte einer geschichtlichen Epoche an, in der das Phänomen einer Regisseurin, Filmtheoretikerin, Kinoaktivistin und Feministin, einer in der Öffentlichkeit wirkenden Frau möglich war. Mit den 1930er-Jahren verschwand es weitgehend aus dem Geschichtsbild.“
Umso dringlicher ist „Women Make Film“, der neben diesen vielleicht noch halbwegs geläufigen Namen auch Dutzende großer Regisseurinnen würdigt, deren Werk auf der Landkarte des Weltkinos für eine größere Öffentlichkeit de facto unsichtbar ist.
Anbei als Service zum Selbsttest ein paar willkürlich herausgepickte Namen: Larissa Schepitko (Sowjetunion), Chantal Akerman (Belgien), Wendy Toye (Großbritannien), Mai Zetterling (Schweden), Kinuyo Tanaka (Japan), Vera Chytilová (Tschechoslowakei), Astrid Henning-Jensen (Dänemark), Helma Sanders-Brahms (Deutschland), Safi Faye (Senegal), Wanda Jakubowska (Polen), Pirjo Honkasalo (Finnland), Elaine May (USA), Sarah Maldoror (Frankreich), Lucretia Martel (Argentinien) – nennen Sie jetzt bitte einen Film pro Regisseurin.
Zugegeben, dieses Spielchen würde mit Regie-Machos aus Spanien, Großbritannien oder Albanien genauso (nicht) funktionieren, aber in der Regel käme man vermutlich schneller an ihre Filme heran. „Women Make Film“, an dem Cousins nach eigener Aussage über fünf Jahre lang gearbeitet hat, ist nicht zuletzt eine ganz außerordentliche Produktionsleistung.
Mit dokumentarischer Ausgewogenheit hat Mark Cousins nichts am Hut, dazu ist der Mann ein viel zu leidenschaftlicher Cineast. Wie radikal subjektiv – und doch präzise – seine Auswahl ist, veranschaulicht ein Blick auf die österreichischen Filmemacherinnen, die darin vertreten sind. So beispielsweise Valie Export mit ihrem experimentellen Horrorfilm „Unsichtbare Gegner“, Jessica Hausner mit „Lourdes“ und die Allroundkünstlerin Mara Mattuschka mit „NabelFabel“, einem ihrer frühen Kurzfilme. Selbst auf heimischem Terrain wird man sich hier gut behandelt fühlen.