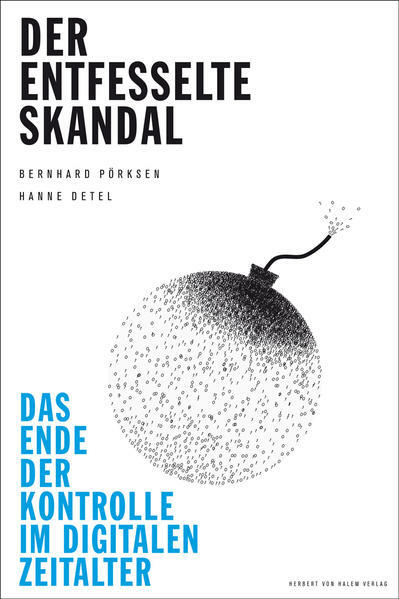Menschenfleischsuche: die tägliche Hetzjagd im Internet
Kirstin Breitenfellner in FALTER 4/2013 vom 23.01.2013 (S. 16)
Das Internet verleiht Skandalen eine neue Dynamik, die auf archaische Triebe baut und bei denen schon einmal der Tod des Opfers gefordert wird
Wenn ein Opfer berühmt oder mächtig ist, reichen oft Kleinigkeiten, um einen Skandal auszulösen. Und Skandal heißt immer auch: Medienhatz. Eine Medienhatz macht besonders Spaß, wenn sie "moralisch" gerechtfertigt erscheint. Etwa wenn die Fallhöhe des "Täters" hoch genug ist, wie bei Ministern oder Bundespräsidenten, wie die Skandale um Theodor zu Guttenberg oder Christian Wulff in Deutschland gezeigt haben. Oder wenn man jemanden im Namen der Opfer verfolgen kann – Kriegsverbrecher, Vergewaltiger, Pharmakonzerne et cetera.
Gemeinsam ist solchen "Skandalen" oft, dass Details des Vorfalls in der Öffentlichkeit oft unbekannt bleiben; und dass sie schnell eine herrschende Meinung entstehen lassen.
Bernhard Pörksen und Hanne Detel analysieren eine neue Form von Skandal: den "entfesselten Skandal". Er findet im Internet statt. Und er kann von jedem lanciert werden. Mussten bis vor kurzem noch Journalisten als Gatekeeper über das wahre Ausmaß eines Skandals urteilen, so reicht heute oft ein privates Mail, ein Tweet oder Facebook-Kommentar, um ihn ins Rollen zu bringen. Traf der Skandal früher ausschließlich einflussreiche und bekannte Menschen oder Institutionen, so kann er heute jeden beliebigen Bürger treffen.
Strahlkraft und Brutalität
Die neuen Opfer sind gänzlich Unschuldige, zufällige Passanten, Menschen, die nie um Aufmerksamkeit gebeten haben, Medientölpel, die sich durch Unwissenheit oder einen falschen Mausklick einem Massenpublikum ausliefern. Pörksen und Detel stellen in "Der entfesselte Skandal. Das Ende der Kontrolle im Zeitalter der digitalen Medien" die Frage, wie die traditionellen Medien, die diese Internetskandale analysieren und damit oft noch verstärken, mit den neuen Opfern umgehen sollen, ohne ihnen nur noch mehr zu schaden – und die Autoren kommen dabei zu keinem befriedigenden Schluss. Dennoch lohnt es sich, ihr Buch zu lesen, denn seine Problematik kann jeden betreffen.
Der "entfesselte Skandal" lässt sich schon aufgrund der schieren Zahl der Akteure nicht mehr kontrollieren. Und er hat keine Ablaufzeit, weil das Internet bekanntlich nicht vergisst. "Das digitale Zeitalter hat seine eigene Schönheit und seinen eigenen Schrecken", schreiben Pörksen und Detel, "es besitzt Strahlkraft und Brutalität."
Das einst bloß passive Publikum ist zum handelnden Akteur aufgestiegen, zur "publizistischen Großmacht", und braucht keine professionelle Ausrüstung mehr, sondern nur ein Smartphone mit Kamera und Internetzugang. Diese "radikale Demokratisierung" verleiht Einzelnen eine bis dahin unbekannte Macht – von der auch Gebrauch gemacht wird.
Die Autoren führen eine Reihe von Fällen an: von Marc Drudge, der auf seiner Internetseite als Erster den Lewinsky-Skandal veröffentlichte, bevor er bestätigt war, und damit beinahe den amerikanischen Präsidenten Bill Clinton zu Fall brachte, über den Blogger, der im Sommer 2010 maßgeblich dazu beitrug, den deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler über unbedachte Äußerungen zum Afghanistan-Einsatz stürzen zu lassen, bis zu Julian Assange, den Wikileaks-Gründer, der vom Jäger zum Gejagten wurde.
In diesen Fällen kann man noch einen klaren politischen und moralischen Kontext erkennen. Beim Beispiel einer jungen Chinesin, die im Mai 2008 via Youtube die Opfer eines Erdbebens beschimpfte, weil sie sie indirekt daran hinderten, ihr Lieblingscomputerspiel zu spielen, und dann selbst zum Opfer eines rachsüchtigen Cybermobs wurde, wird die Geschichte schon verwirrender.
"Renrou Sousuo" heißt in China "Menschenfleischsuche". Der Begriff beschreibt die "auf dem Prinzip des Crowdsourcing beruhende Detektivarbeit des Cybermobs", der sich neuer Medien bedient, um uralten Gefühlen Ausdruck zu verleihen, bei denen nicht selten der Tod des Opfers gefordert wird. Und bei denen das Ausmaß der Strafe in keinem akzeptablen Verhältnis mehr zur Schwere des Vergehens steht.
Neid und Schadenfreude
Eigentlich stellt der Skandal eine Art und Weise dar, sich über Werte zu verständigen – besonders in Gesellschaften, in denen traditionelle Werte zunehmend ihre Verankerung zu verlieren drohen. Meistens ist es einfach leichter zu sagen, was man schlecht findet, als zu definieren, was gut ist.
Im "Moment der kollektiven Empörung probt die Allgemeinheit das große moralische Gespräch und erklärt sich, welche Werte gelten oder doch gelten sollten".
Aber solange auf dem Altar der moralischen Gefühle, auf die sich die Masse einigen kann und hinter denen allzu oft doch nur Ressentiments – Neid, Schadenfreude – stecken, noch Menschen geopfert werden, fällt es schwer, diesem Prozess etwas Gutes abzugewinnen.
In einer Gesellschaft, in der jeder mit einem Überwachungsapparat ausgerüstet ist, wird aus Tugend- und Normenkontrolle allzu schnell eine Menschenjagd. Justiz wird zu Selbstjustiz und die angebliche Analyse des Geschehens in den konventionellen Medien wird nur zu einem weiteren Skandal, der den Skandal offiziell zum Skandal erklärt und sich gleichzeitig davon ernährt.
"Wessen Geschichte zählt?", fragen die Autoren am Ende des Buches: "Die des von einem Cybermob ruinierten Opfers oder die Geschichte des arabischen Frühlings, die Twitter, Facebook und den Möglichkeiten der effektiven Schwarmbildung so entscheidende Anstöße verdankt?" Diese etwas naiv gestellte Frage bestätigt aber nur den alten Schluss, dass technischer Fortschritt sich nie als allein positiv oder negativ beschreiben lässt, sondern dass es immer erst der Mensch ist, der dem Fortschritt seine Form gibt.