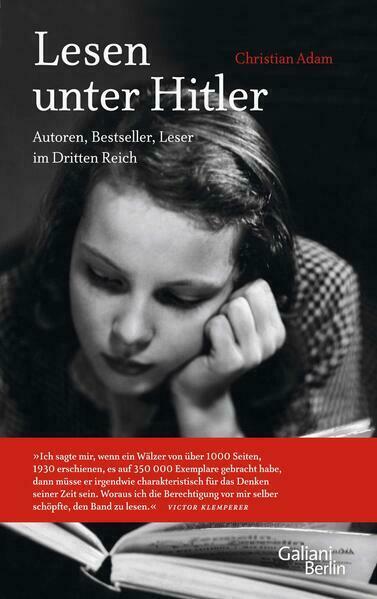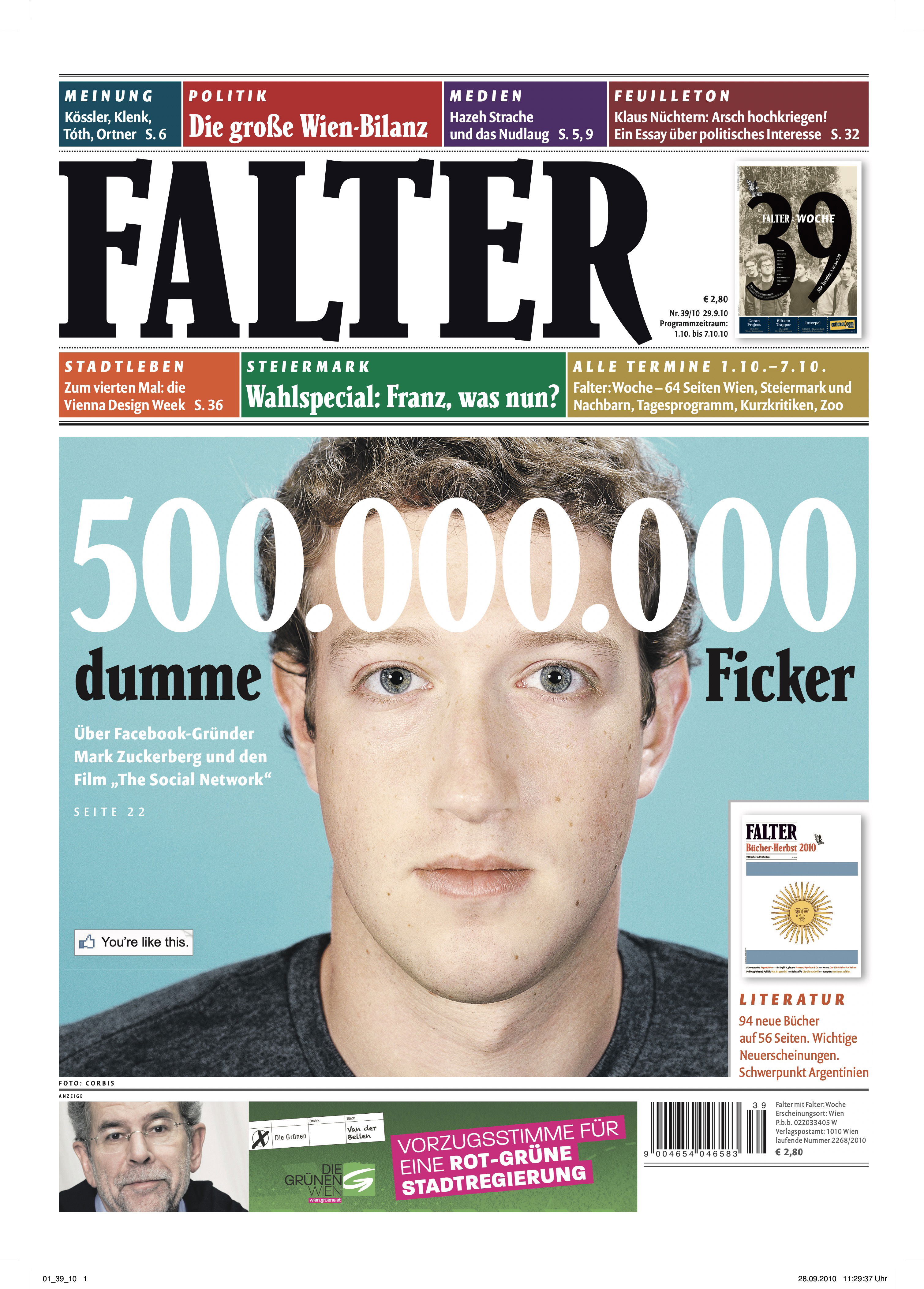
15 Millionen Reichsmark für Autor Hitler
Alfred Pfoser in FALTER 39/2010 vom 29.09.2010 (S. 14)
Erich Maria Remarques "Im Westen nichts Neues" war der erste große Bestseller der deutschen Literaturgeschichte. Im Erscheinungsjahr 1929 wurde eine Million Exemplare verkauft. Als dann der Film herauskam, wurde die Popularität noch größer. Die Nazis schäumten, Remarque avancierte mit Buch und Film zum literarischen Lieblingsgegner der NS-Bewegung – und zugleich zum Maßstab für die eigene literarische Produktion.
Bestseller wollten auch die Nazis. Bucherfolge sollten Einfluss auf Haltungen und Stimmungen nehmen, entsprechend drehten sie an den Schrauben des Literaturmarkts, verbrannten Bücher, konzentrierten das Verlagswesen, "arisierten" jüdische Verlage, zwängten die Autoren in die Reichsschriftumskammer, lenkten durch Vorgaben und Verbotslisten, schoben den NS-Verlagen große Aufträge zu.
Besonders konzis war diese Politik allein schon aufgrund des Kompetenzwirrwarrs nicht. Zu viele Organisationen kümmerten sich um die Leser und Leserinnen. Und dann gab es, bei allen enggehaltenen Freiräumen, immer noch so etwas wie einen freien Literaturmarkt. Weil ihnen die Buchhändler die Treue hielten, überlebten kleinere Verlage abseits des NS-Mainstreams. Wie die Ausleihe in den kommerziellen Leihbüchereien (nicht in den kommunalen Volksbüchereien) zeigt, gab es allerdings auch viele Nischen, wurden zum Teil sogar verbotene und verbrannte Autoren weiterhin in Umlauf gehalten.
Christian Adam nimmt die Erfolgsbücher und die Erfolgsautoren des Dritten Reichs unter die Lupe und kommt in seiner materialreichen, gut lesbaren Studie zu unerwarteten Ergebnissen. Untersucht wurden jene rund 350 Bücher, die in mehr als 100.000 Exemplaren gedruckt wurden. Wobei sich Adam dabei nicht nur auf Romane beschränkt, sondern auch Sachbücher, Ratgeber oder die Heftchenliteratur mit einbezieht und das Bild durch quantitatives Zahlenmaterial wie Lektüreerfahrungen anreichert.
Dass die rechten Kriegsbücher hoch im Kurs waren, erstaunt nicht: Die Vorbereitung zum Krieg erfolgte auch auf dem Buchmarkt. Dass Hitler ein begeisterter Karl-May-Leser ist, ist ebenso bekannt wie die Liebe der NS-Literaturpolitiker zur sogenannten Blut-und-Boden-Literatur. Allerdings rückt Adam die Dimensionen zurecht und macht die Komplexität der Branche wie des Lektüreverhaltens sichtbar.
Die Lieblingsgenres des Publikums deckten sich nicht unbedingt mit dem, was die Politik vorsah. Die Blubo-Literatur erwies sich eher als Ladenhüter. Und unter den Kriegsbüchern waren auch solche erfolgreich, die für die deutsch-französische Verständigung warben. Bemerkenswert auch der Erfolg von Margaret Mitchells "Vom Winde verweht". Georges Simenon wurde beworben. Dass Hamsun gefiel, war angesichts dessen politischer Einstellung nicht verwunderlich; dass aber Antoine de Saint-Exupéry, der gegen die Nazis Flugeinsätze flog, mit seinem Besteller "Wind, Sand und Sterne" bis April 1945 in den Läden erhältlich war, verblüfft doch.
Viel ideologisch unauffällige Literatur kam zu Leseehren. Die in der DDR beliebten "Heiden von Kummerow" von Ehm Welk kamen schon in der Nazidiktatur gut an. Von einer erfolgreichen Gleichschaltung der deutschen Lektüre kann man jedenfalls nach dem Befund von "Lesen unter Hitler" nicht sprechen. Selbst die Nazibosse labten sich an englischen Krimis, an Jules Verne oder Hermann Hesse. "Ein bisschen Entspannung, das tut so gut", notierte Goebbels 1940.
Nach der Machtergreifung wollten zwar viele Nazis am großen Kuchen des Buchmarkts mitnaschen, aber nicht alle machten mit Nazibüchern gute Geschäfte. Wenn die Käufer nicht wollten, halfen die NS-Organisationen durch Geschenke, Pflichtankäufe oder penetrantes Marketing nach. Hitlers "Mein Kampf" gab es in den Standesämtern für jedes Brautpaar, wodurch es eine Auflage von insgesamt 12,5 Millionen Exemplaren erreichte und Hitler ein Honorar von 15 Millionen Reichsmark bescherte. "Kampf um Deutschland"; eine Geschichte der NSDAP, erzählt vom Euthanasieexekutor Philipp Bouhler, musste in sämtlichen Schulen und Jugendverbänden gelesen und deshalb 1,5 Millionen Mal gedruckt werden.
Joseph Goebbels verschaffte sich mit seinem Buch zur Machtergreifung "Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei" Bestsellerehren und kam auf 600.000 Stück. Auch unkonventionelle Vertriebswege wurden zur Propaganda in Anspruch genommen: Reemtsma, Kooperationspartner von Goebbels' Ministerium, fügte den Zigarettenschachteln Fotos bei, die in millionenfach verbreiteten Alben eingeklebt wurden.
Eine Stunde null gab es nicht. Adam veranschaulicht die merkwürdigen Kontinuitäten zwischen der Nazi- und der Nachkriegszeit, beschäftigt sich intensiv mit dem Werdegang vieler Autoren. Während Hans Zöberlin, Autor des erfolgreichen Buchs "Glaube an Deutschland", von seiner Hitler-Begeisterung nicht abließ, waren die meisten Autoren wendiger und umtriebiger, strichen Passagen und veränderten leicht den Titel, um ihre Erfolgsbücher, wie "Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind" (nach 1945 ohne "deutsche"), im Rennen zu halten. Auch die höchst erfolgreichen Doku-Fictions um deutsche Erfinder und Erfindungen, um Rohstoffe und Rohstoffhandel (Schenzingers "Anilin" verkaufte 1,6 Millionen Exemplare) blieben, nach leichten Eingriffen, weiterhin gut im Geschäft. Der Bertelsmann-Konzern verstand sich schon während der NS-Zeit ganz ausgezeichnet auf die Produktion von Bestsellern und konnte dieses Know-how auch nach 1945 nutzen.