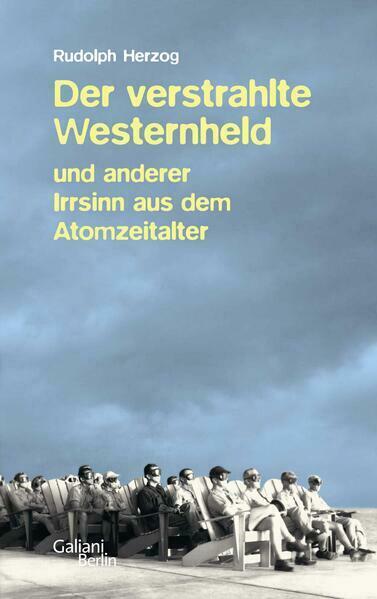Dr. Seltsams strahlende Hinterlassenschaften
Karin Chladek in FALTER 11/2012 vom 14.03.2012 (S. 32)
Atomzeitalter: Rudolph Herzog über Opfer und Nachwirkungen des atomaren Wettrüstens
Vieles, was man nie so genau über den atomaren Wettkampf im Kalten Krieg und über dessen bis heute nachwirkende Kollateralschäden wissen wollte, erfährt man in "Der verstrahlte Westernheld". Ohne Anspruch auf Vollständigkeit erzählt Rudolph Herzog die kurze, aber folgenreiche Geschichte des Atomzeitalters.
Die Überwindung, sich auf mehr Information über die strahlenden Hinterlassenschaften von Dr. Seltsam & Co einzulassen, lohnt sich: Viele haarsträubende Anekdoten machen den Irrsinn, der die Anwendung von Nukleartechnologie war und ist, zwar deutlich – gleichzeitig wird das Buch trotz der abschreckenden Thematik aber zur spannenden und letztendlich unterhaltsamen Lektüre.
John Wayne könnte eines der prominentesten Strahlenopfer gewesen sein. Ob die Krebserkrankung, die ihn schließlich tötete, auf Dreharbeiten in einem durch Bombentests radioaktiv verseuchten Canyon in Utah oder auf Waynes Kettenraucherei zurückzuführen ist, wird man wohl kaum jemals wirklich wissen. Zu denken gibt allerdings folgende Tatsache: Von den 220 Mitgliedern von Cast und Crew des Kostümschinkens "The Conqueror", der 1956 mit John Wayne und Susan Hayward in den Hauptrollen gedreht wurde, erkrankten 91 an Krebs, 46 davon waren bis 1980 daran gestorben. Auch Wayne und Hayward.
Wie Rudolph Herzog, auch ein renommierter Dokumentarfilmer und Producer, anmerkt, wäre es sicher aufschlussreich gewesen, die Krebsraten bei den tausenden indianischen Statisten zu untersuchen, die durch ihre Reitereinsätze im Canyonstaub der Radioaktivität besonders ausgesetzt waren. Doch ihre Spuren sind verwischt, ihr Leben war nach den Dreharbeiten nicht weiter von öffentlichem Interesse.
Wie ein roter Faden zieht sich die besondere Betroffenheit von indigenen Völkern durch die Geschichte der Nukleartests. Denn Regierungen und Militärs zogen weltweit ihre atomaren Experimente bevorzugt in Regionen durch, die als "menschenleer" galten, es aber meist nicht waren. In den USA, in Australien, Polynesien, der damaligen Sowjetunion – überall traf es indigene Völker, die in den Jahrzehnten zuvor oft erst in jene entlegenen Gebiete abgedrängt worden waren, die nun zu atomaren Spielwiesen der Regierungen wurden.
Nicht nur für militärische, auch für zivile Einsatzversuche von atomarer Technik wurden bevorzugt die Heimatregionen indigener Völker "auserkoren". In den USA machte sich der Physiker und "Vater der Wasserstoffbombe" Edward Teller jahrzehntelang für ein "friedliches" Nuklearprogramm stark, das im Wesentlichen darin bestehen sollte, Atombomben für großangelegte Bauarbeiten einzusetzen. Ein erstes Prestigeprojekt sollte ein künstlicher Hafen in Alaska sein.
Das Projekt hatte neben horrenden Kosten den Schönheitsfehler, dass gerade einmal 50 Kilometer vom angenommenen "Ground Zero" entfernt 317 Menschen eines Inuitstamms im Dorf Point Hope lebten. Anders als bei den meisten militärischen Nukleartests konnten sie sich gegen die atomare Zerstörung ihrer Heimat wehren: Auf Druck von Medien, Forschung und nicht zuletzt des Dorfrats wurde das Hafenprojekt 1962 eingestellt.
Kasachische Hirtennomaden hatten nicht so viel Glück: In einem totalitär regierten Staat wie der Sowjetunion hatten sie kaum Möglichkeiten, sich ähnlichen Experimenten in ihrer Heimat entgegenzustellen.
Rudolph Herzog beschreibt anhand besonders prägnanter Fälle, wie über 40 Jahre lang naive Technikgläubigkeit, skrupelloses Machtstreben und kindisches "Will auch haben" (auch bekannt als "Gleichgewicht des Schreckens") die damaligen Großmächte zu einem Wettlauf in der militärischen wie zivilen Nutzung der Kernenergie trieben. Aus heutiger Sicht ist weder die globale Paranoia des Kalten Kriegs noch die Gedankenlosigkeit hinsichtlich der Langzeitfolgen der atomaren Experimente nachvollziehbar.
Das einstige nukleare Wettrüsten wirkt allerdings noch lange nach, sei es durch Proliferation von waffenfähigem Plutonium, Atomprogramme unberechenbarer Regierungen wie des Iran oder die andauernde Verseuchung von ganzen Regionen. Das vielleicht größte Problem ist aber der Umgang mit radioaktivem Müll: Lange Zeit war "Aus den Augen, aus dem Sinn" die beliebteste Methode aller Beteiligten, wenn es um die Lagerung und Entsorgung nuklearer Abfälle ging. Das geht mit unserem heutigen Wissensstand nicht mehr.
Auch die Behörden zumindest in demokratisch regierten Staaten agieren nicht mehr so grob fahrlässig wie in der Vergangenheit. Dennoch oder gerade deshalb werden die Probleme mit dem strahlenden Erbe des Kalten Kriegs eher größer als kleiner.