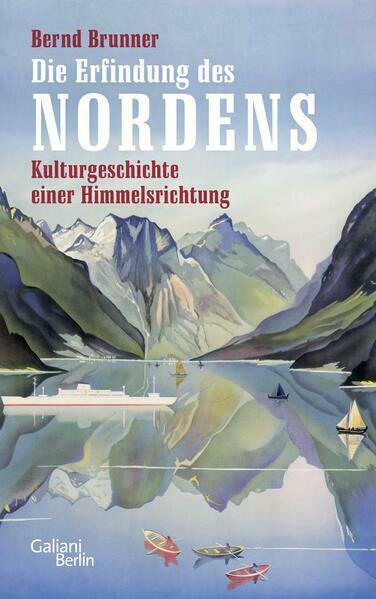Nordlicht, Narwal, Nibelungen und Nazis
Oliver Hochadel in FALTER 41/2019 vom 09.10.2019 (S. 49)
Kulturgeschichte: Bernd Brunner porträtiert den geografischen Norden als Sehnsuchtslandschaft „links vom Sonnenaufgang“
Die These steckt bereits im Titel: „Die Erfindung des Nordens“. Für Bernd Brunner ist der Norden „nichts, was in einer bestimmten Form für alle Zeiten Bestand hätte, er unterliegt dem historischen Wandel – und wird dabei immer wieder neu erfunden bzw. konstruiert“. Die „Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung“, so der Untertitel, versammelt ein buntes Panorama dieser sich verschiebenden Imaginationen und Aneignungen des Nordens von der Antike bis heute.
Etymologisch steht Norden wohl für „links vom Sonnenaufgang“. Geografisch ist damit oft, aber nicht immer Skandinavien inklusive Dänemark und Island gemeint. Auch der Nordpol, Grönland und der Norden Kanadas gehören je nach Epoche und Perspektive dazu. Selbst Russland lag für Mitteleuropäer mental lange im „Norden“, bevor es dann im 20. Jahrhundert zum „Osten“ wurde. Brunners Buch ist flüssig und angenehm unaufgeregt geschrieben, wirkt mitunter aber auch beliebig. Über weite Strecken beschäftigt sich der Kulturhistoriker vor allem damit, inhaltlich verwandte Belegstellen aneinanderzureihen. Schon die große Anzahl von 29 Kapiteln zeigt, wie heterogen das angehäufte Material ist.
Das Nordlicht, die Inuit, echte und erfundene nordische Dichtungen, der Narwal, die arktische Nacht und die Mittsommernacht, Jack London und Henrik Ibsen, Carl von Linné und die Lappen, Reisende auf Selbsterfahrungstrips wie die österreichische Schriftstellerin Christiane Ritter auf Spitzbergen, alles kommt irgendwann mal vor.
In der zweiten Hälfte des Buches taucht dann aber doch ein wiederkehrendes Narrativ auf: der Norden als Projektionsfläche für die Suche nach Ursprüngen, gestützt auf die Edda und andere Sagen, aber auch Bilder von Caspar David Friedrich, zwischen Romantik und Nationalismus. Die Götterwelt, aber auch die „wilde“, „unberührte“ Natur zwischen Fjorden und Nordkap lieferten Versatzstücke zur Konstruktion kultureller Identitäten. Brunner dokumentiert insbesondere die Nordsucht völkischer Strömungen seit Ende des 19. Jahrhunderts.
Damals grassiert eine Wikinger-Manie, der sich die Briten, aber mehr noch die Deutschen lustvoll hingaben. Die Uraufführung von Richard Wagners „Ring der Nibelungen“ 1876 in Bayreuth illustriert dies eindrücklich. Die Sänger setzten sich Helme mit Hörnern oder gar Flügeln auf, auch wenn klare Belege fehlen, dass die Wikinger tatsächlich solche trugen. „Wagners Siegfried ist der nordische Held, der die Welt erlöst“, merkt Brunner an.
Diese Vereinnahmungsversuche von Schriftstellern und Komponisten, aber auch Rassekundlern und Eugenikern wie Hans F. K. Günther lassen sich bis in den Nationalsozialismus hinein verfolgen. „Reinen Blutes“, ursprünglich und unverdorben – so stellte man sich den nordischen Menschen vor. Bei dieser Suche ging es sogenannten völkischen Autoren vor allem darum, die enge Verwandtschaft von germanischer und nordischer Kultur nachzuweisen, um sich so von der angeblich dekadenten westlichen Zivilisation abzugrenzen.
Wilhelm II. etwa verstand sich als Nachfahre der Wikinger und machte zwischen 1889 und 1914 fast jeden Sommer Urlaub mit seiner Jacht in Norwegens Fjorden. „Es zieht mich mit magischen Fäden zu diesem kernigen Volke“, schwadronierte der deutsche Kaiser. Auch für Normalbürger wurde Skandinavien zu jener Zeit touristisch erschlossen und unter dem Slogan „Nordische Wochen“ beworben. Dabei traf die hehre Projektion mitunter auf die gar nicht so raue Wirklichkeit. Die Reisenden fanden zu ihrer Ernüchterung schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine fortschrittliche Gesellschaft vor. Rechtsstaatlichkeit, die Anfänge des Sozialstaats, Forderungen nach Gleichberechtigung der Geschlechter und Toleranz Andersdenkender waren gerade nicht die Werte, die Deutschnationale im hohen Norden gesucht hatten. Der NS-Chefideologe Alfred Rosenberg beklagte denn auch 1934: „Skandinavien ist es zu gut gegangen, es ist satt und faul geworden. Die Wikinger sind ausgewandert.“