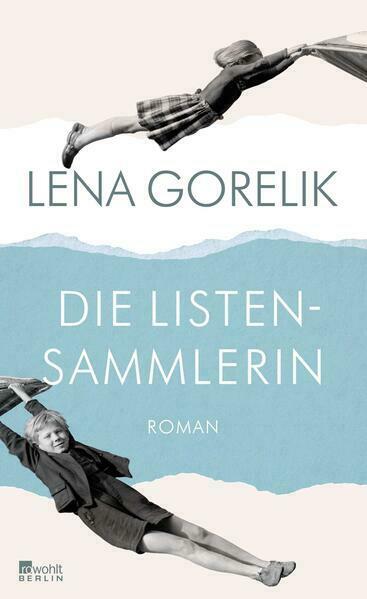Plastilinschwäne und Panini-Bildchen
Erich Klein in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 29)
Der irre Osten hat nach wie vor Konjunktur – etwa in den Romanen von Tanja Maljartschuk und Lena Gorelik
Zufälle regieren die Welt, wer sie als Tollhaus beschreibt, hat a priori recht. Diese Einsicht plus Balkan-Pop und Ostalgie sind verantwortlich für eine Flut von Büchern osteuropäischer Autorinnen, die in den letzten Jahren auf das Erfolgsrezept setzten, um mehr oder weniger erfolgreich auf die Zustände vor der Haustür des westlichen Alltags hinzuweisen.
Vordergründig gilt das auch für Tanja Maljartschuk und Lena Gorelik, die auf höchst unterschiedliche Weise daran erinnern, dass der von ihnen beschriebene Karneval der Grausamkeit und des schwarzen Humors nicht allein bloßer Bobo-Ergötzung dient. Irrenhäuser waren im Osten schließlich mehr als Irrenhäuser.
Aberwitz herrscht im Romandebüt der seit zwei Jahren in Wien lebenden Tanja Maljartschuk (Jahrgang 1983) von der ersten Seite an. In "Biografie eines Wunders" wird die Kindergartentante Frau Dutt von einem Kugelblitz getroffen. Von ihr bleibt nur ein Plastilinschwan, der leitmotivisch durch das ganze Buch treibt. Anstatt sich gut ukrainisch-patriotisch "Olena" oder "Olenka" zu nennen – die Geschichte spielt im westukrainischen Iwano-Frankiwsk, Geburtsort der Autorin und Bollwerk des ukrainischen Nationalismus –, beharrt die Protagonistin auf der russifizierten Namensvariante "Lena".
Eigensinn ist es, der Lena ihre rabiate Coming-of-Age-Geschichte vorerst heil überstehen lässt: Sie verteidigt die Kindergärtnerin, ätzt über den Religionsfimmel, der sich nach dem offiziellen Staatsatheismus der Kommunisten im Land breitmacht. Eine typisch ukrainische Biografie in den 1990er-Jahren sieht ohnedies drastischer aus: "Die einen gingen nach Charkiw, um Polizist zu werden und Menschen auszurauben, die anderen schrieben sich für Medizin ein, um Leute umzubringen."
Kurz: Hinter den Karpaten triumphieren Sex, Crime & Money, und Tanja Maljartschuk lässt nichts davon aus. Als da sind: der Fleischverkäufer, der Lena nach zehn Dates den ersten Kuss abnötigt; der ewig linkische und depressive Vater, der partout kein Visum in die USA bekommt und es stattdessen mit dem Anbau von Buchweizen versucht; oder der Sportstudent Darwin, der wie ein Affe aussieht und bei nationalistischen Umtrieben eine Buchhandlung abfackelt. In einem Land, in dem ohnehin alles nur abstrus ist, versucht schließlich auch Lena auf einschlägige Weise zu Geld zu kommen – sie schaltet eine Annonce, "Wunder auf Bestellung", und wird prompt selbst reingelegt.
Lenas Wandlung zur Tierschützerin wirkt ob der Witze über Hunde und Chinarestaurants ein wenig altbacken, das lange Finale, in dem sie für die Kindheitsfreundin mit dem merkwürdigen Namen "Hund" einen Rollstuhl erkämpft, gerät hingegen zu einem fulminant beschriebenen Höllentrip ins Irrenhaus – Kafka und Thomas Bernhard lassen grüßen. "Wer bist du?", fragt die Erzählerin ihre Protagonistin am Schluss. "Ich bin ein Mensch der fünften Generation." Zurück bleiben nur ein gelbes Kopftuch mit dunkelroten Blüten, besagter Plastilinschwan und die Beteuerung der Erzählerin: "Solche Geschichten gibt's. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere
"
Nicht weniger maximalistisch beginnt Lena Gorelik, 1981 in Leningrad geboren und 1992 samt russisch-jüdischer Familie als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland übersiedelt, ihren bislang fünften Roman, "Die Listensammlerin": "Man gewöhnt sich an alles, auch an die Angst." Auch Gorelik konstruiert ihre Erzählung über große Geschichte und kleine Gegenwart zu einem Kreisschluss; anders als Maljartschuk evoziert sie aber keine wie auch immer sarkastisch dargestellte posttotalitäre Kindheit.
In der Welt der Ich-Erzählerin Sofia herrscht hysterischer deutscher Alltag. Sofias anstrengende Mutter tauscht mit Schwiegersohn Flox Panini-Bilder, die Großmutter befindet sich auf dem Weg ins Altersheim, Tochter Anna steht eine Herzoperation bevor. Die russisch-deutschen Familienbande entstanden, als Stiefvater Frank seinerzeit in der Sowjetunion Literaturwissenschaft und Tolstoi studierte und – obschon anfänglich überzeugter Kommunist – die drei Frauen in den Westen "errettete".
Seit ihrer Kindheit hat Sofia den Tick, Listen über alles und jedes anzulegen – etwa über "Schimpfwörter der Jungs", oder eine Liste der "Menschen, die Flox beim Suchen helfen". "Die Listen gaben mir Kraft und Ruhe wie anderen das Gebet, Drogen, ein Therapeut, die Zigaretten und das Shoppen." Listen dienen dabei nicht nur als Ordnungsversuch gegen das Chaos, sie geben auch die Richtung der Erzählung vor.
Eine Liste "von Männern mit schönen Händen" gehört schon zur Welt des ominösen, in der russischen Vergangenheit zurückgebliebenen Onkels Grischa. Auf dessen Außenseitergeschichte stößt Sofia zufällig, als sie im Kasten der Großmutter stöbert – der "Maler aus Berufung, aber ohne Talent", von Kindheit aufmüpfig, war seinerzeit zum Dissidenten geworden und hatte Sofias leiblichen Vater mit ins Verderben gerissen. Beide landeten in der Psychiatrie. Onkel Grischas Vermächtnis sind Listen – etwa solche von verbotener Literatur von Solschenizyn bis Brodsky.
Lena Goreliks Versuch, die Geschichten zweier Generationen über Raum und Zeit hinweg zu synchronisieren, bleibt eigentümlich fahl, die Vergangenheit, auch wenn sie sich in einigen Symptomen zu wiederholen scheint, bleibt vergangen. Die Dramatik des Romans steigert sich nur einmal, als die Großmutter aus der Geriatrie entwischt und die Herzoperation von Tochter Anna erfolgreich verläuft. Flox streicht Sofia über die Schulter, die im Krankenhaus zu schreiben beginnt: "Man gewöhnt sich an alles, auch an die Angst."