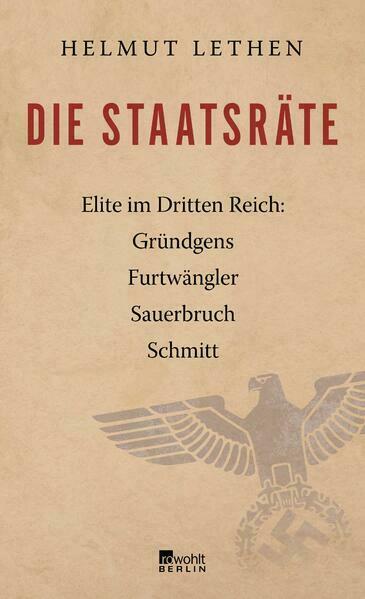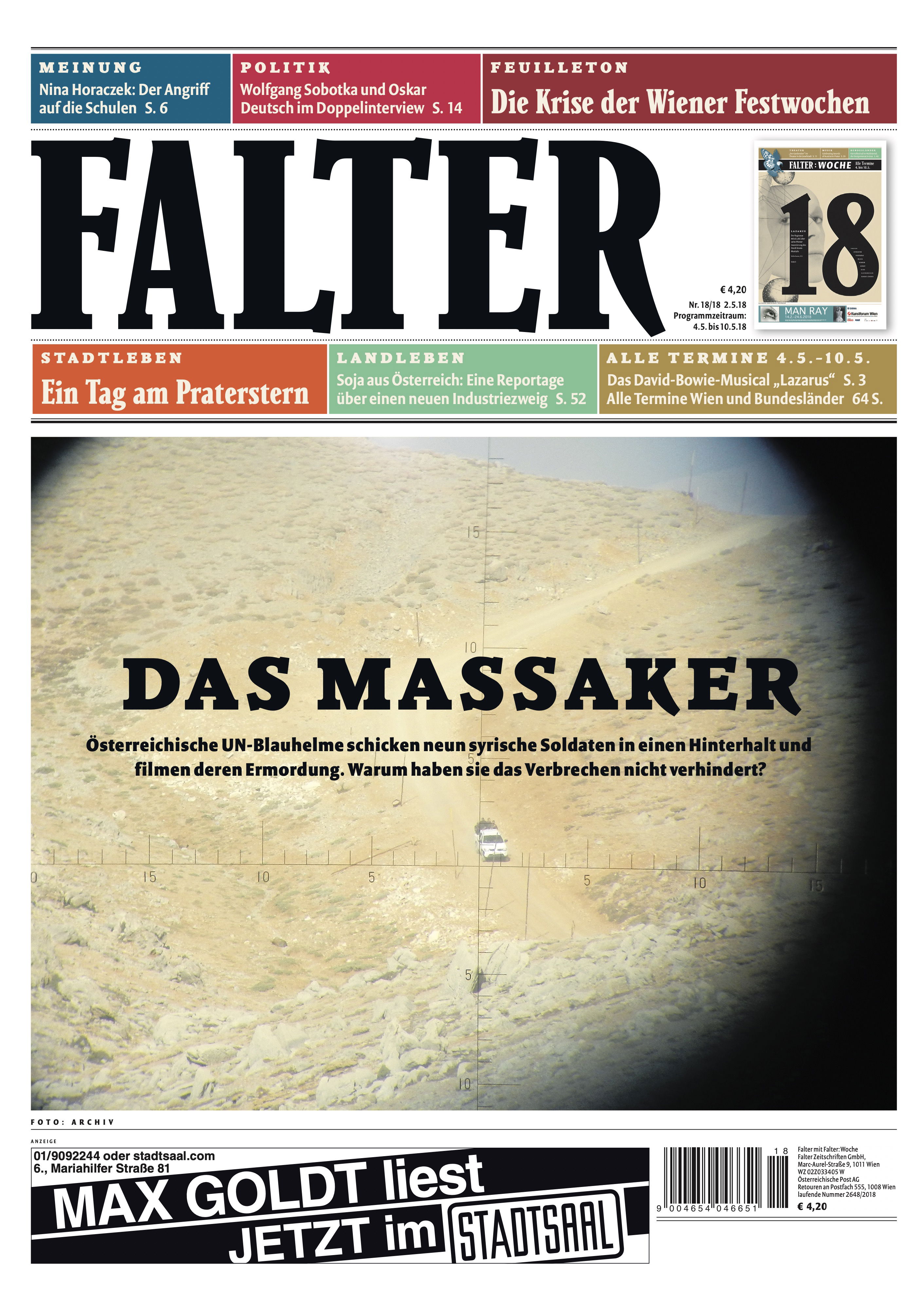
„Das Böse ist geil, aber nur im Theater“
Matthias Dusini in FALTER 18/2018 vom 02.05.2018 (S. 34)
Der 68er Helmut Lethen über die Faszination der RAF, gebildete Nazis und den Erfolg der Neuen Rechten
Im Herbst war der Germanist Helmut Lethen noch nicht bereit. Damals wollte ihn der Falter zu seiner Frau Caroline Sommerfeld-Lethen, die Mitglied der Identitären Bewegung ist, befragen. Wie kann ein 68er mit einer Rechten zusammenleben? Er werde seinen Standpunkt in seinem neuen Buch erläutern, wehrte Lethen ab. Inzwischen liegt sein sehr lesenswertes Werk „Staatsräte“ vor, in dem es um Künstler und Wissenschaftler geht, die sich vom Nationalsozialismus vereinnahmen ließen. Einer von ihnen, der politische Philosoph Carl Schmitt, lieferte die juristische Rechtfertigung für den Führerstaat; in der Neuen Rechten steht er heute wieder hoch im Kurs.
Über familiäre Dinge wollte Lethen auch diesmal nicht sprechen, dafür gab er Auskunft über den Mai 68 und die kriminelle Energie der Bewegung. Das Gespräch fand in der Buchhandlung Gläsernes Dachl in der Burggasse in Neubau statt, in dem das Ehepaar Lethen seine Bücher bestellt.
Falter: Herr Lethen, wie fit waren Sie im Mai 68?
Helmut Lethen: Ich war sehr fit. Ich stamme aus einer Leichtathletikfamilie und war als Jugendlicher ein mittelerfolgreicher Mittelstreckler. Was uns 1968 glücklich gemacht hat, war zum einen die Körpermotorik der Aktion. Zum anderen haben wir die Archive der schweigenden Väter aufgebrochen. Wir haben auf eigene Faust unglaublich intensiv studiert. Diese Kombination macht mich immer noch froh.
An welche Aktion denken Sie zuallererst?
Lethen: An eine sehr unerfreuliche am 2. Juni 1967, als in Berlin gegen den Schah von Persien demonstriert wurde. Ich stand mit meiner Frau und vielen anderen vor der Oper, als plötzlich die Polizisten über den Zaun sprangen, eine Technik, die übrigens in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs entwickelt wurde. Sie haben uns nach links und rechts weggedrängt. Der damalige Polizeipräsident Erich Duensing hat das als „Auspressen einer Leberwurst“ bezeichnet. Bei der panikartigen Flucht verlor ich einen Schuh. Plötzlich sah ich einige Polizisten über mir, die mich mit Schlagstöcken traktierten. Das Merkwürdige war, dass ich keinen Schmerz verspürte.
Was geschah dann?
Lethen: Meine Frau war vorausgelaufen, drehte sich um und kam zurück. Sie ist die Tochter eines Boxers und versetzte einem der Männer einen Faustschlag. Der hatte so etwas noch nie erlebt, und die Polizisten ließen von mir ab. Wenige Minuten später wurde Benno Ohnesorg in einem Hinterhof erschossen. Bis dahin haben wir den Staat theoretisch bekämpft, aber der Hautkontakt mit der Staatsgewalt war etwas Neues und Ungeheuerliches. Wir haben gedacht, das ist Faschismus. Die folgenden Halluzinationen eines Ausnahmezustands hatten viel mit diesem 2. Juni zu tun. Die Linken verwechselten die BRD mit dem NS-Staat, die Medien fantasierten eine Revolution herbei.
Sie sagen, Sie hätten viel studiert. Wie gehen Aktion und Bücherobsession zusammen?
Lethen: Mit der Körpermotorik wollten wir aus der bleiernen Schwere der Adenauer-Atmosphäre herauskommen. Die obsessive Lektüre hat dazu geführt, dass ich alle Bücher als Speicher von Bewegungslehren gelesen habe. Es gibt einen dunklen Punkt meiner Biografie, der diese Kollision zum Ausdruck bringt.
Und zwar?
Lethen: Der Germanist Peter Szondi kam an die Freie Universität (FU) und wurde wie ein Star empfangen. Er sah aus wie ein hochgewachsener Stehgeiger. Ich erlebte mit ihm den Purismus der Textnähe, der mich in die Flucht getrieben hat.
Was heißt das?
Lethen: Walter hatte ein Gedicht von Charles Baudelaire zu interpretieren. Szondi bat ihn an die Tafel zu gehen und mit Kreide die erste Strophe an die Tafel zu schreiben. „Die können Sie ja sicher auswendig“, sagte er. Dann ließ er ihn das Wörterbuch Larousse aufschlagen und nachsehen, welche Bedeutungen das Wort „queue“ hat, das in der ersten Strophe vorkommt. Walter las die acht verschiedenen Möglichkeiten vor und Szondi sagte: „Ach, und dann haben Sie sich für die eine entschieden? Ihre Entscheidungsfähigkeit ist ja allerhand.“ Das war eine solche Demütigung, dass ich das Seminar verlassen habe.
Sie haben sich gerächt.
Lethen: Für die schreckliche Verwüstung von Szondis Institut bin ich mitverantwortlich. Wir sind reingegangen und haben Plakate von den Wänden gerissen. Einige Mitstreiter haben Bücher geklaut. Szondi hat genau gewusst, wer das war, und hat davon Abstand genommen, den Staatsanwalt einzuschalten. Der Höhepunkt meiner Beschämung bestand darin, dass er später alles daran gesetzt hat, dass ich eine Professur in Bremen bekommen sollte.
Der Mai 68 wird gegenwärtig vor allem von der politischen Rechten diskutiert. Wie nehmen Sie diese Abrechnung wahr?
Lethen: Ein Teil der Neuen Rechten hält 68 für eine Folge der amerikanischen Gehirnwäsche nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt bereits im Tagebuch von Carl Schmitt Klagen über die von der „re-education“ hervorgebrachte Schuldkultur. Armin Mohler, ein Vordenker der Neuen Rechten, stellte die These auf, die Bundesrepublik sei am Nasenring der Schuldkultur in den Untergang gezogen worden.
Wie reagieren Sie auf diese Deutungen?
Lethen: Durch Forschungen. Die Fabel von der Gehirnwäsche nach 1945 kann durch kein Dokument belegt werden. Wie lange hat die Justiz gebraucht, bis es zum ersten Auschwitz-Prozess kam! Der Staatsanwalt Fritz Bauer musste sich 1963 gegen die gesamte Zunft der Juristen durchsetzen. In meiner ganzen Gymnasiumszeit, von 1950 bis 1959, ist kein einziges Mal auf den Massenmord hingewiesen worden. Meine erste Begegnung mit dem Holocaust war der Film „Nacht und Nebel“ von Alain Resnais, in dem man die Leichenberge in den Konzentrationslagern sah. Das hat sich mir als Jugendlichem tief in die Seele gebrannt. Das waren für mich Gedenksteine, die ich mir von niemandem ausreden lasse.
Heute assoziiert man Bewegung eher mit rechts. Wie konnte es dazu kommen?
Lethen: Man kann die Studentenbewegung und ihre seltsamen Imitationen der Kommunistischen Partei als letzte Ausläufer einer heroischen Moderne bezeichnen. Ihre Akteure glaubten, dass sie kraft ihrer Organisationen und der Wucht des Volkswillens die Geschichte mitreißen können. Zu meiner Überraschung war das nicht der letzte Atemzug dieses Heroismus. In der rechten Bewegung entdecke ich einen neuen, letzten Atemzug. Weiß der Teufel, wie viel jetzt noch kommen. Ich bin tief durchdrungen von der Idee, dass die Geschichte für uns nicht verfügbar ist. Daher hat für mich die Vorstellung, man könne den Lauf der Dinge durch einen puren Willensakt beeinflussen, überhaupt keinen Reiz mehr.
Für Sie nicht. Warum dann für andere?
Lethen: Offensichtlich verströmte die lange vorherrschende Politik mit ihren großen Koalitionen eine derart bleierne Langeweile, dass man aus ihr ausbrechen wollte. Das Böse ist einfach geil. Die Ästhetisierung des Bösen ist wie in den 60er-Jahren ein Auslöser für neue Bewegungsenergien, ein Begriff, den Walter Benjamin geprägt hat. Man muss sich die Frage stellen, inwiefern vernünftigere Parteien diese Faszination eines Aufbruchs außer Acht lassen.
War 1968 vielleicht gar nicht so links?
Lethen: Der Historiker Götz Aly sagt, dass die Studentenbewegung eine Wiederkehr der Hitlerjugend war. Der rechte Autor Karlheinz Weissmann sagt, dass sie ein endzeitlicher Aufbruch war, der zur Dekadenz der Republik geführt hat. Mit der Kategorie des Linken kommen wir nicht weiter. Die 68er-Bewegung war als Aufbruch ein Zeichen der Sehnsucht nach Welt. Das hieß auch Solidarität mit Kämpfen von Völkern in fernen Ländern. Die Melodie dieser Sehnsucht war die Popkultur.
Aus der Studentenbewegung entstanden die dogmatischen K-Gruppen, deren Mitglied Sie wurden. War das ein Rückschritt?
Lethen: Die Studentenbewegung fächerte sich am Ende der 60er-Jahre auf. Es gab die Lebensstilfraktion, die sich dann auch durchgesetzt hat. Dazu kamen der kleine Kreis der Roten Armee Fraktion und Anfang der 70er-Jahre die K-Gruppen. Meine These ist, dass diese vor allem maoistischen Kleinparteien ein Glücksfall für die Bundesrepublik waren. Die kriminelle Energie der Bewegung wurde in diesen Apparaten ins Tiefkühlfach gestellt. Meine Partei war nach außen hin absolut harmlos und verschlang alle Kräfte für die Disziplinierung ihrer Mitglieder.
Gab es auch Gutes?
Lethen: Die Besetzung des Bonner Rathauses etwa. Wir wollten verhindern, dass der Staatspräsident von Südvietnam empfangen wird. Er war eine Marionette der Amerikaner, die im Vietnam Krieg führten. Obwohl die Stadt hermetisch abgeriegelt war, gelang es dem Führungsstab meiner Partei, das waren nicht mehr als drei, vier Hanseln, den Kordon zu durchbrechen. Plötzlich standen tausende Menschen vor dem Rathaus und stürmten das Gebäude. Diese Aktion finde ich auch heute noch richtig.
Sie wirken nicht gerade wie ein Dogmatiker. Wären Sie in einem indischen Ashram nicht besser aufgehoben gewesen?
Lethen: Man könnte auch sagen: Ich floh in diesen Parteiapparat aus Angst vor frei flottierender Sexualität. Da war man sicher und kam nicht auf dumme Gedanken. Diese spartanische Partei schützte mich, meine Frau und Kinder vor den Lebensstilexperimenten. Außerdem hatten wir Freunde in der Kommune 1, die uns vom Terror der Nähe berichteten. Wenn es eine Tyrannei der Intimität gab, dann in diesen Wohngemeinschaften.
Gab es Begegnungen?
Lethen: Einmal haben wir aus Protest gegen die Notstandsgesetze das Germanistische Institut besetzt. Dann kam die Kommune 1, installierte riesige Lautsprecher und spielte Rolling Stones. Rainer Langhans schmiss mir ein Buch entgegen, ich hob es auf und sagte: Bist du wahnsinnig? Das ist doch Christoph Martin Wieland, einer der großen Aufklärer! Da sagt Langhans: Ihr Analerotiker, ihr könnt vom Papier nicht lassen.
Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll bestimmen das Bild der Sixties. Warum nicht die K-Gruppen?
Lethen: Der politische Flügel ist nicht geschichtsmächtig geworden. Er wurde von den Wellen der Popkultur weggeschwemmt. Das ist vielleicht ein großes Glück gewesen.
Warum?
Lethen: Wir haben Glück gehabt, dass unsere politischen Intentionen nicht verwirklicht wurden. Das Nützlichste an der Bewegung waren die Widerstände, an denen wir uns abarbeiten mussten. Der lebbare Zustand der BRD war ein Kompromiss, der auf diesen Widerstand zurückging.
In Erinnerung geblieben sind die Hippie-Haare, nicht die Lederjacken der K-Gruppen, die die Arbeiterräte der 1920er-Jahre imitierten. Woher kam diese Liebe zur Radikalität?
Lethen: Sie vergessen bei dieser Aufzählung die RAF. In der Geschichtsschreibung heftet sich die ästhetische Faszination des liberalen Lagers an die Rote Armee Fraktion. Keiner im linken Lager grenzte sich von den Aktionen der RAF so rigoros ab wie die K-Gruppen. Verächtlich sprachen wir in Anspielung auf ein Urteil, das Karl Marx über die bürgerlichen Umstürzler im lumpenproletarischen Mäntelchen prägte, von der Jeunesse dorée, den Kindern reicher Eltern.
Die RAF war cool, Sie waren kalt.
Lethen: Oder umgekehrt. Die RAF wiederholte den Kult des Bösen der Avantgarden vom Ende der 20er-Jahre. In der Scheinheiligkeit des demokratischen Konsenses war das faszinierender als unsere bescheidenen Versuche, Aktionen möglichst theatralisch zu inszenieren.
Waren Sie auch fasziniert vom Kult des Bösen?
Lethen: Natürlich. Eine zentrale Figur meines neuen Buches ist Carl Schmitt, dessen Lebensmotto lautete: Das Leben kräftigt sich am Born des Bösen, Moral leitet ab in den Tod. Einen Schritt, den ich nicht mitmache, ist die Übertragung der ästhetischen Faszination auf das reale politische Geschehen, wie es Schmitt im Nationalsozialismus getan hat. Das Böse soll sich im Theater austoben.
Wie kamen Sie dazu, ein Buch über die Staatsräte des „Dritten Reiches“ zu schreiben?
Lethen: Ein Initialsatz für dieses Buch war eine Sentenz von Friedrich Nietzsche: „Die deutsche Bildung ist ein Handbuch der Innerlichkeit für äußere Barbaren.“ Es geht um virtuose Köpfe mit hohem Esprit, die von einer großen Lebensblindheit auf barbarischem Terrain umringt sind. Ich wollte mir Aufschluss darüber geben, warum Vertreter der Hochkultur ein so inniges Verhältnis zu diesem Mordstaat entwickeln konnten, ohne das Gefühl zu haben, dessen Instrumente zu sein.
Warum machten Sie keine wissenschaftliche Studie, sondern eine historische Erzählung daraus?
Lethen: Ich wollte die vier Staatsräte an einen Tisch setzen und dachte, wenn sie sich angucken, müssten sie eigentlich vor Scham vergehen. Das war die Experimentalanordnung. Es war schwierig, die vier zusammenzubringen: Der Dirigent Wilhelm Furtwängler hatte eine Nackenentzündung, der Regisseur Gustav Gründgens Migräne. Als sie zusammenkamen, war von Scham keine Spur.
Gerade die preußische Kultur war geprägt von Begriffen wie Ehre und Schamgefühl. Wohin sind diese Werte in der NS-Zeit verschwunden?
Lethen: In den Reihen der Verschwörer gegen Hitler sind sie zu finden. In seinem Tagebuch schreibt der später hingerichtete Widerstandskämpfer Ulrich von Hassel: „Nur im richtigen Verhältnis zum Sittengesetz kann ich Achtung vor mir haben.“ Das ist seine Ehre, und wo diese Ehre verletzt wird, entspringt ein starker Bewegungsimpuls, der bis zum Attentat Stauffenbergs auf Hitler führte. Es gab exklusive Räume des bürgerlichen Kriegerethos, wo diese Ehre noch wirklich intakt war. Genau dieses Element fehlt bei meinen vier Halunken.
Was war das Schöne an dieser Arbeit an der Finsternis?
Lethen: Die Klebearbeit. Heimito von Doderer spielt eine wichtige Rolle in dem Buch. Emmy Göring kommt auf dem Landsitz Carinhall den vier Staatsräten strahlend entgegen. Wie soll ich dieses Strahlen beschreiben? Ich nahm das Porträt der Frau Blümerant in Doderers Roman „Ein Mord, den jeder begeht“ und klebe das Plagiat auf das Gesicht der Emmy Göring. Und schon habe ich ein Porträt dieser Frau. Auch aus Doderers fantastischem „Repertorium“ habe ich entscheidende Passagen eingeflochten.
Auch die Neuen Rechten sind von den 20er-Jahren fasziniert. Oder nicht doch eher vom Nationalsozialismus der 30er-Jahre?
Lethen: Ich hoffe nicht, dass Letzteres zutrifft. Ich fürchte, dass unsere Unfähigkeit, mit diesen Strömungen umzugehen, zu ihrer Radikalisierung beiträgt. Bei ihrer Theorie handelt es sich um ein merkwürdiges Agglomerat von Fragmenten, von der Systemtheorie Niklas Luhmanns bis zu Friedrich Nietzsche. Jetzt wäre ein günstiger Moment, um in Operationen des Dialogs einzutreten. Ob man in deren Gedankengebäude wirklich eindringen kann, weiß ich nicht.
Soll man mit Rechten reden?
Lethen: Ich fände es gut, wenn man die Rechten in Foren locken könnte, in denen sie sich wirklich mit Argumenten auseinandersetzen müssten. Der Boykott jeder Veranstaltung, an der einer von ihnen teilnimmt, ist kindisch. Die Wiener Identitären halte ich für harmlos. Ihr Lesepensum ist unglaublich, das Quantum an Bewegung, daran gemessen, eher gering. Eine merkwürdige Truppe.
Zentrale Begriffe sind Identität und Volk. Was ist schlecht daran?
Lethen: In meinem Buch habe ich mich mit der schwierigen Konstruktion der Volksgemeinschaft beschäftigt und bin draufgekommen, dass eigentlich niemand dazugehört. Auch die vier Staatsräte haben das Gefühl, dass sie nicht Teil davon und vollkommen einsam sind. Was heißt denn Identität eines Volkes? Erst schält man aus dem Trichter den äußeren Ring aus Kommunisten und Sozialdemokraten weg. Dann kommt flächendeckend das Rausschälen der jüdischen Mitbürger, dann Roma und Homosexuelle. Der Trichter wird immer kleiner. Was bleibt dann übrig? Das Verblüffende am Nationalsozialismus ist, dass nicht die deutsche Rasse übrigbleibt, sondern die Herrenrasse der SS, deren Aufgabe es ist, in einem Jahrhundert die deutsche Rasse erst herzustellen.
Was ist falsch an der Sehnsucht nach Heimat und Region?
Lethen: Es war sicher ein Fehler der Linken, diese Themen zu vernachlässigen. Die Losung der Frankfurter Schule war, wir sind nur in der Entfremdung zu Hause. In der multiethnischen Theorie kann man diese Haltung auch heute noch finden. Das Andere ist besser als das Eigene.
Seit dem Fluchtjahr 2015 heißt es, wir sind nicht mehr Herr im eigenen Haus. Stimmt das?
Lethen: Das ist empirisch nicht beweisbar. Man hat aber die Schwierigkeiten der Integration maßlos unterschätzt. Das ist ein Kampfgebiet auf kommunaler Ebene, und es bedarf ungeheurer Anstrengungen, um das ins Positive zu wenden.
Ihr Linksextremismus hat Sie eine Beamtenlaufbahn gekostet. Haben Sie 1968 bereut?
Lethen: Nein, nie. Was hätte schon aufregend sein sollen an einer 40-jährigen Beamtenlaufbahn? Die historische Konstellation hat mehr aus mir herausgeholt, als in mir drin war. Ich war ein Glückskind.