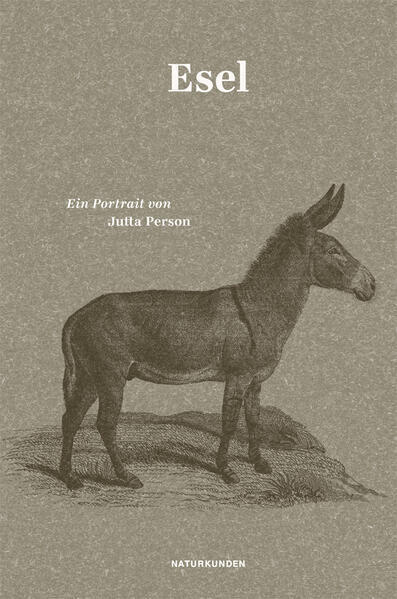Das Tier und wir: von Eseln bis zu Insekten
Peter Iwaniewicz in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 31)
Reihenporträt: Seit Frühjahr 2013 erscheint bei Matthes &Seitz Berlin die wunderbare Reihe "Naturkunden"
Bücher müssen gut riechen", meinte einmal der Verleger Klaus Wagenbach und schlussfolgerte, "dass die DDR deswegen untergegangen ist, weil die Bücher so gestunken haben". Die Reihe "Naturkunden" bei Matthes & Seitz Berlin lässt hingegen bibliophile Menschen wieder auf eine bessere Zukunft hoffen. Denn diese riechen nicht nur wunderbar nach Druckerschwärze und Leinenbatist, sondern sind ein editorisches Manifest einer neuen Zuwendung zur belebten Natur.
"Brehms Thierleben" beschrieb den Lesern das Leben wilder Tiere ab 1864 moralinsauer und anthropomorphisierend. Bernhard Grzimeks 13-bändige Enzyklopädie sah Tiere ab 1971 vor allem durch die Brille der Naturwissenschaften, reduzierte sie auf messbare Dimensionen und beraubte sie damit ihrer Seele und kulturgeschichtlicher Facetten.
Die "Naturkunden", herausgegeben von der jungen Autorin Judith Schalansky, hingegen bemühen sich mit spürbarer Leidenschaft um eine gesamtheitliche Durchdringung der belebten Welt. Als Leser folgt man den Autoren gerne auf den verschlungenen Pfaden einer Naturgeschichte, die sowohl Geschichte als auch Geschichten bietet.
Jutta Persons Porträt der Esel etwa lässt einen von der ersten Zeile an die Faszination spüren, die Tiere auf uns Menschen ausüben können. Als Haustiere sind bzw. waren Esel vertraute, aber dennoch auch immer rätselhafte Wesen. Berüchtigt für ihre Sturheit und ihre Huftritte dienen sie uns auch als animistische Identifikationsobjekte. Der nur scheinbar passiv alle Demütigungen seines Herren ertragende Esel schüttelt sein Joch im Märchen von den "Bremer Stadtmusikanten" mit einem für eine globalisierte Gesellschaft geradezu paradigmatischen Satz ab: "Etwas Besseres als den Tod finden wir überall."
Oder wir finden uns im Esel als jenem "Hippietier" wieder, dessen Ohren der Welt mit ihrer V-Stellung stets ein VictoryZeichen zeigen. Sehr angenehm auch die kompakte Dimension dieses Leseritts durch die Welt der Grautiere: Auf 150 Seiten findet man feine Illustrationen, Essays zu Charakterkunde und Philosophie des Eseltums sowie Porträts von Eselrassen. Nach der letzten Seite bleibt nur mehr der Wunsch nach der Begegnung mit einem echten Esel offen.
Tiere, die ein behaartes Gesicht mit Nase, Mund und Ohren haben, also Säugetiere, können sich eher unserer Sympathie sicher sein als etwa Tiere, die unter Wasser leben und die die meisten nur geräuchert, gebraten oder mariniert kennen. Obwohl solche Behandlungen bekanntlich jede natürliche Schönheit ruinieren, ist der Hering ein schönes Tier. Holger Teschke erzählt vom Heringsblick, dem "blitzenden Glanz, den die Heringe von sich werfen, wenn sie in Scharen schwimmen", und beschreibt den Hering als Kosmopoliten und Überlebenskünstler. Heringe leben als Vagabunden zwischen ihren Fress-, Laich- und Überwinterungsplätzen. Auf ihren Wanderungen legen sie bis zu 4000 Seemeilen zurück und durchqueren dabei Süß-und Salzwasser.
Neben historischen Fakten erfährt man auch Kurioses: Wie Wale können Heringe Töne produzieren, die auch für Menschen hörbar sind und "Heringsfurzen" genannt werden. Das war der schwedischen Marine offenbar nicht bekannt, die in den 1970er-Jahren sowjetischen Atom-U-Booten nachspürte, die sie für die Urheber verdächtiger Unterwassergeräusche hielt. Nach Untersuchungen von Meeresbiologen wurden die Erkenntnisse als "geheim" klassifiziert, um eine Blamage zu verhindern. Auch in dieser würdigen Apologie einer von Überfischung bedrohten Tierart begleiten ausgezeichnete Bilder und Illustrationen den Text.
Das Wort Pädagogik leitet sich aus pais (gr., Knabe) und ágein (gr., führen, leiten) ab. Im antiken Griechenland hatte der Pädagoge als Knabenführer die Aufgabe, diese zur Philosophie zu führen und so zu erziehen. In ebendiesem Sinn führt uns der Anthropologe Hugh Raffles mit seiner "Insektopädie" an eine Tiergruppe heran, die voll erstaunlich vollendeter Wesen ist. Sein Streifzug, in spielerischer Weise alphabetisch geordnet, erzählt zu jedem Buchstaben eine Geschichte, die genauso schillert und changiert wie der an Insektenflügel erinnernde Buchdeckel.
Wie ein Schmetterling flattert Raffles dabei durch Wissenschaft und Philosophie, Anthropologie und Zoologie, Wirtschaft und Populärkultur, wobei immer auch Menschen im Fokus seiner Betrachtungen stehen. Seine Erkundungen sind meist persönlich, oft sprunghaft und immer sehr belesen. Manchmal bietet er nur eine kurze Impression einer von Insekten geformten Klanglandschaft in einem Park, dann wieder porträtiert er auf 26 exzellenten Seiten den Insektenforscher Jean-Henri Fabre.
Bisweilen wird einem als Leser dabei fast schwindlig, aber das entspricht auch dieser Tiergruppe, über die Raffles in der Einleitung schreibt: Sie halten nicht still.
Jürgen Goldstein, Professor für Philosophie an der Universität Koblenz, begleitet sehr unterschiedliche Menschen bei ihrer Auseinandersetzung mit der Natur. Als Basis dienen ihm deren literarische Beschreibungen, die zitiert, kommentiert und zu einer Erfahrungsgeschichte fusioniert werden. Das klingt sperriger, als es sich liest. Mit Reinhold Messner besteigt er so den Mount Everest, mit Charles Darwin erreicht er den Galapagos-Archipel.
Stets suchen der Autor und seine Literaten die verlorene Wildnis und blicken durch die Begegnung mit einer stets wilden oder abenteuerlichen Natur auf sich selbst. Wenige historische Illustrationen begleiten die Texte, wobei sich nicht erschließt, wieso gerade diese ausgewählt wurden. Was fehlt, aber stets über den Geschichten schwebt, sind die Bilder Caspar David Friedrichs.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: