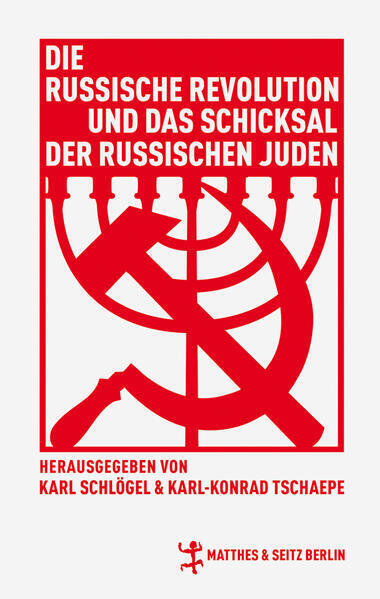Wer macht die Revolution, und wer muss sie bezahlen?
Erich Klein in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 46)
Geschichte: Karl Schlögel beleuchtet das Verhältnis Russlands zu den Juden anhand von Berliner Debatten der 1920er-Jahre
Wer von Russen, Juden und der Revolution spricht, begibt sich auf vermintes Terrain. "Die Juden waren schuld an der Oktoberrevolution und dem Untergang Russlands!", schreien die Antikommunisten. "Jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung", fügen die Nazis hinzu. Hitler rechtfertigte den Überfall auf die Sowjetunion mit deren Bekämpfung. Antisemitismus als Totschlagargument verbindet beides.
Der Umstand, dass sich am Umsturz aller Verhältnisse im Petrograd des Jahres 1917 – der zur folgenreichsten politischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts wurde – tatsächlich eine beträchtliche Anzahl von Revolutionären jüdischer Herkunft beteiligte, macht die Sache nicht einfacher.
Der emeritierte Osteuropahistoriker Karl Schlögel stellt gleich zu Beginn von "Die Russische Revolution und das Schicksal der russischen Juden" klar: "Kommunisten waren innerhalb des Judentums immer nur eine winzige Minderheit, und Juden hatten in ihrer überwältigenden Mehrheit mit dem Kommunismus nichts zu tun."
Was Schlögel, der für eine "nicht tribunalisierende Geschichtsschreibung" plädiert, an diesem Gegenstand mit großem polemischem Potenzial eigentlich interessiert, bleibt ein wenig im Unklaren. Möglicherweise geht es ihm um die endgültige Widerlegung der "Argumente" der Nazis.
Seine Entdeckung des "Vaterländischen Verbandes russischer Juden im Auslande" im Berlin der 1920er-Jahre – ein Gegenstand, für den Schlögel ein ausgewiesener Experte ist – und vor allem des Aufrufes "An die Juden aller Länder!", der 1922 erfolgte, ist jedenfalls spektakulär.
"Die Trotzkis machten die Revolution, aber die Bronsteins müssen dafür bezahlen", heißt es da in Anspielung auf den bürgerlichen Namen des Revolutionsführers Leo Trotzki. Im Klartext: Die große Masse der Russen wird "die Juden" für den Umsturz aller Verhältnisse, der sich alsbald als nicht besonders gelungen erwies, zur Rechenschaft ziehen.
Besagte Emigrantenorganisation war auch verantwortlich für die Publikation zweier Bücher, deren Übersetzung den Hauptteil des Buches darstellt. Da ist einerseits die dreihundertseitige Schrift "Die Russische Revolution und die Judenheit. Bolschewismus und Judentum" von Daniil Pasmanik mit Überlegungen zur Rolle, die der Erste Weltkrieg für die Oktoberrevolution spielte, zum Verhältnis von antibolschewistischen "Weißen" und Juden sowie einer Untersuchung der Pogrome in der Ukraine während des Bürgerkrieges.
In "Die Umwälzung in Russland und das Schicksal der russischen Juden" reflektieren sechs Publizisten, Historiker und Politiker jüdisch-russisches Selbstverständnis nach der Revolution und gehen der Frage nach, wie wichtig die "Protokolle der Weisen von Zion", jener Grundtext aller neueren Antisemiten, tatsächlich waren. Es geht um das Verhältnis zu den Juden anderer Länder und zum Zionismus. Auch hier erklärt Pasmanik dezidiert: "Wir sind für die Trotzkis verantwortlich, solange wir uns von ihm nicht losgesagt haben." Der Publizist und Historiker Josef Schechtman konstatiert: "Einstein ist nicht eine Errungenschaft der jüdischen, sondern der deutschen nationalen Kultur."
Die Geschichte der russischen Juden nach der Oktoberrevolution ist gleichermaßen eine "historia activa" wie eine "historia lacrimosa", eine "Geschichte der Frommen und eine Geschichte der Schamlosen", wie es die Publizistin Sonja Margolina (die Ehefrau von Karl Schlögel) schon vor fast zwanzig Jahren in ihrem Essay "Das Ende der Lügen" formulierte. Mit 5,3 Millionen Juden war die Sowjetunion das Zentrum des europäischen Judentums.
Die russischen Juden demonstrierten in den 1920er-Jahren mehrheitlich nicht nur Loyalität zur kommunistischen Herrschaft; die Schaffung jüdischer Theater und die Aktivitäten zahlreicher jüdischer Schriftsteller und Künstler von Isaak Babel über Marc Chagall bis El Lissitzky lassen geradezu von einer Blüte jüdischer Kultur sprechen.
Das "tragische Erfolgsmodell", wie der Historiker Jurij Slezkin diese jüdische Sowjet-Integration bezeichnete, wurde durch Hitler und danach durch Stalin beendet. Drei Millionen sowjetischer Juden wurden von den Nazis ermordet; für Stalin war es in der Folge nicht besonders schwierig, die Erinnerung daran in der Gesamtzahl der sowjetischen Kriegstoten von 27 Millionen verschwinden zu lassen.
In den Jahren 1968 bis 1994 verließen 1,2 Millionen sowjetischer Juden das Land, heute leben in der Russländischen Föderation nur noch 230.000 Juden. Eine Auseinandersetzung mit Alexander Solschenizyns "Zweihundert Jahre gemeinsam", der die Geschichte des russischen Judentums in der Gegenwart beendet sah, beschließt Karl Schlögels kleine Geschichte des "jüdischen Kommunismus".
Nicht ohne eine Aufgabe zu formulieren, die der deutsche Historiker selbst nicht mehr leisten kann: "Dem postsowjetischen russischen Judentum wird eine nicht geringe Rolle zufallen, die Geschichte der russischen Juden im 20. Jahrhundert zu erzählen und ein Narrativ zu finden, in dem die komplexesten und widersprüchlichsten Erfahrungen aufgehoben sind."
Dann darf man die Frage nach dem "jüdischen Bolschewismus" als endgültig beantwortet verstehen.